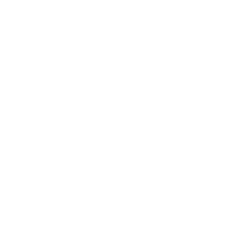Wann wird ein Händler als Hersteller betrachtet?
Laut Artikel 3 Nr. 8 der General Product Safety Regulation (GPSR) ist „„Hersteller“ jede natürliche oder juristische Person, die ein Produkt herstellt oder entwerfen oder herstellen lässt und dieses Produkt in ihrem eigenen Namen oder unter ihrer eigenen Handelsmarke vermarktet.“
Außerdem gilt als Hersteller:
Artikel 13 Absatz II GPSR: „Wenn eine natürliche oder juristische Person, bei der es sich nicht um den Hersteller handelt, das Produkt wesentlich verändert, gilt sie, sofern sich die wesentliche Änderung auf die Sicherheit des Produkts auswirkt, für die Zwecke dieser Verordnung als Hersteller und unterliegt für den von der Änderung betroffenen Teil des Produkts oder für das gesamte Produkt den Pflichten des Herstellers nach Artikel 9.“
Als wesentlich gilt die Änderung dann, „wenn sie sich auf die Sicherheit des Produkts auswirkt und die folgenden Kriterien erfüllt sind:
- Durch die Änderung wird das Produkt in einer Weise verändert, die in der ursprünglichen Risikobewertung des Produkts nicht vorgesehen war;
- aufgrund der Änderung hat sich die Art der Gefahr geändert, ist eine neue Gefahr entstanden oder hat sich das Risikoniveau erhöht; und
- die Änderungen wurden nicht von den Verbrauchern selbst oder in ihrem Auftrag für ihren eigenen Bedarf vorgenommen.“
Professionelle Rechtsberatung vom Anwalt
Guter Rat ist teuer? Nicht bei uns. Unsere auf E-Commerce-Recht spezialisierten Anwälte stehen dir bei rechtlichen Fragen gern zur Seite.
Ruf einfach an oder schreibe eine E-Mail.
Wie müssen Textilien gekennzeichnet werden?
Damit eine einheitliche Textilkennzeichnung im gesamten EU-Raum erreicht werden kann, dürfen nur bestimmte im Gesetz vorgeschriebene Begriffe verwendet werden. Die Angabe von Markennamen oder Firmenbezeichnungen wie “Spandex”, “Lycra” oder “Pashmina” reichen für eine korrekte Kennzeichnung nicht aus. Ebenso dürfen Wortverbindungen oder Eigenschaftsworte nicht verwendet werden (siehe § 4 Abs. 3 Textilkennzeichnungsgesetz), beispielsweise das Wort “Merinowolle”. Da das Gesetz diese Bezeichnung nicht kennt, lautet die korrekte Bezeichnung in diesem Fall “Wolle”.
GPSR: Welche Informationen müssen auf das Textiletikett?
Die GPSR verlangt, dass alle in der EU verkauften Produkte sicher sind. Für Textilprodukte bedeutet dies, dass bestimmte Informationen auf dem Etikett oder der Verpackung angegeben werden müssen, damit Verbraucher alle relevanten Details auf einen Blick erkennen können. Diese Vorschriften dienen der Transparenz und sollen den sicheren Gebrauch der Produkte gewährleisten.
Materialzusammensetzung:
Die Anteile der verwendeten Fasern müssen in Prozent angegeben werden. Beispiele:
- „100 % Baumwolle“
- „80 % Wolle, 20 % Polyester“
Diese Angabe hilft Verbrauchern, Allergien oder andere gesundheitliche Risiken zu vermeiden.
Pflegehinweise:
Zwar nicht gesetzlich vorgeschrieben, aber dringend empfohlen: Symbole oder Hinweise zur Pflege des Produkts, wie z.B. Waschtemperaturen, Bügelvorgaben oder chemische Reinigung. Dies verhindert Schäden durch falsche Behandlung und fördert die Langlebigkeit des Produkts.
Name und Adresse des Herstellers und Importeurs:
Es müssen Name, Adresse und elektronische Adresse des Herstellers angegeben werden. Sitzt der Hersteller nicht in der EU, muss zusätzlich eine verantwortliche Person mit Sitz in der EU angegeben werden. Diese Angaben müssen auf dem Produkt oder der Verpackung leicht erkennbar sein. Sie dienen dazu, den Hersteller bei Fragen, Reklamationen oder Problemen schnell identifizieren zu können.
Chargennummer oder andere eindeutige Produktkennzeichnung:
Jedes Produkt muss eine eindeutige Identifikationsnummer tragen, wie z.B. eine Chargennummer, Modellnummer oder Seriennummer. Diese dient dazu, Produkte im Falle eines Produktrückrufs oder anderer Sicherheitsmaßnahmen eindeutig zuzuordnen. Die Nummer kann auf dem Etikett, der Verpackung oder einer beigelegten Karte angegeben werden.
Textilkennzeichnung im Online-Shop
Der Händler muss sicherstellen, dass die Kunden die Angaben zur Textilkennzeichnung vor dem Kauf des Produktes zur Kenntnis nehmen. Die Angaben sollten daher direkt in die jeweiligen Produktbeschreibungen bei den abgebildeten Produkten aufgenommen werden.
Ist die Angabe erst durch eine weitere Verlinkung wie bspw. auf „Details“ möglich, sollte bei den Abbildungen auf der Produktseite ausdrücklich darauf hingewiesen werden, wie der Verbraucher die Informationen erhält. Diese Angabe kann z.B. so erfolgen: „Informationen zur Textilkennzeichnung finden Sie hier“ oder „Für Informationen zur Textilkennzeichnung bitte auf „Details“ klicken. Eine bloße Verlinkung auf z.B. „Details“ — ohne einen solchen ausdrücklichen Hinweis — ist unzureichend und es kann zu einer Abmahnung der Textilkennzeichnung kommen.
Schon gewusst?
Mit unserem Textilkennzeichnungstool für Händlerbund-Mitglieder helfen wir dir teure Fehler in der Textilkennzeichnung zu vermeiden und Abmahnungen vorzubeugen. Erfahre in wenigen Schritten, ob deine Produkte kennzeichnungspflichtig sind und wie die Kennzeichnung erfolgen muss: Jetzt Mitglied werden
Kennzeichnungspflichtige Textilien
Alle Textilerzeugnisse. Ein Textilerzeugnis ist laut der gesetzlichen Definition:
- Ein Erzeugnis mit einem Gewichtsanteil an Textilfasern von mindestens 80 %
- Bezugsmaterial für Möbel, Regen- und Sonnenschirme mit einem Gewichtsanteil an Textilkomponenten von mindestens 80 %
- Textilkomponenten von Fußbodenbelägen (obere Schicht), Bezügen von Matratzen und Campingartikeln — sofern die textilen Komponenten einen Gewichtsanteil von mindestens 80 % dieser oberen Schichten / Bezüge darstellen
- Textilien, die in andere Waren eingearbeitet sind und zu deren Bestandteil werden, sofern ihre Zusammensetzung angegeben ist, z.B. ein Bürostuhl
Nicht kennzeichnungspflichtige Textilien
Es sind zwei Ausnahmen vorgesehen:
- Textilerzeugnisse, die lediglich zur Verarbeitung an Heimarbeiter oder selbstständige Unternehmen übergeben werden
- Maßgeschneiderte Textilerzeugnisse, die von selbstständigen Schneidern hergestellt wurden
Beispiel: Ein Kunde gibt einem Schneider Stoff, dieser schneidert ein Kleid und der Kunde nimmt das Kleid dann.
Textile Teile von Schuhwaren (z.B. das Innenfutter), Reißverschlüsse, Nadelkissen oder auch Topflappen und Topfhandschuhe müssen nicht zwingend gekennzeichnet werden. Die vollständige Liste findest du in der EU-Verordnung Nr. 1007/2011 ab Seite 18. In Anhang VI findest du Ausnahmen, bei denen globale Kennzeichnung ausreicht.
Folgen bei Nichteinhaltung
Ein Verstoß gegen die Textilkennzeichnungspflicht stellt gemäß § 12, Art.1 TextilKennzG eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße von bis zu 10.000 € geahndet werden kann. Eine fehlerhafte oder gänzlich fehlende Textilkennzeichnung nach dem Textilkennzeichnungsgesetz kann einen wettbewerbsrechtlichen Verstoß laut dem Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb (UWG) begründen. Häufig führt dies zu Abmahnungen, in denen ein Unterlassungsanspruch geltend gemacht wird.
Abmahnung erhalten? Wir helfen sofort!
Übersicht über die zulässigen Bezeichnungen der Textilfasern
Folgende Faserbezeichnungen sind gemäß Anhang 1 der EU-Verordnung Nr. 1007/2011 bei der Kennzeichnung von Textilerzeugnissen, die nach dem 08.05.2012 in den Verkehr gebracht worden sind, ausschließlich zulässig:
| Bezeichnung | Beschreibung der Faser | |
|---|---|---|
| 1 | Wolle | Faser vom Fell des Schafes (Ovis aries) oder ein Gemisch aus Fasern von der Schafschur und aus Haaren der unter Nummer 2 genannten Tiere |
| 2 | Alpaka, Lama, Kamel, Kaschmir, Mohair, Angora(-kanin), Vikunja, Yak, Guanako, Kaschgora, Biber, Fischotter, mit oder ohne zusätzliche Bezeichnung „Wolle“ oder „Tierhaar“ | Haare nachstehender Tiere: Alpaka, Lama, Kamel, Kaschmirziege, Angoraziege, Angora-kanin, Vikunja, Yak, Guanako, Kaschgoraziege, Biber, Fischotter |
| 3 | Tierhaar, mit oder ohne Angabe der Tiergattung (z.B. Rinderhaar, Hausziegenhaar, Rosshaar) | Haare von verschiedenen Tieren, soweit diese nicht unter den Nummern 1 und 2 genannt sind |
| 4 | Seide | Faser, die ausschließlich aus Kokons seidenspinnender Insekten gewonnen wird |
| 5 | Baumwolle | Faser aus den Samen der Baumwollpflanze (Gossypium) |
| 6 | Kapok | Faser aus dem Fruchtinneren des Kapok (Ceiba pentandra) |
| 7 | Flachs bzw. Leinen | Bastfaser aus den Stängeln des Flachses (Linum usitatissimum) |
| 8 | Hanf | Bastfaser aus den Stängeln des Hanfes (Canna-bis sativa) |
| 9 | Jute | Bastfaser aus den Stängeln des Corchorus olitorius und Corchorus capsulatis. Im Sinne dieser Verordnung sind der Jute gleichgestellt: Fasern aus Hibiscus cannabinus, Hibiscus sabdariffa, Abutilon avicennae, Urena lobata, Urena sinuata |
| 10 | Manila | Faser aus den Blattscheiden der Musa textilis |
| 11 | Alfa | Faser aus den Blättern der Stipa tenacissima |
| 12 | Kokos | Faser aus der Frucht der Cocos nucifera |
| 13 | Ginster | Bastfaser aus den Stängeln des Cytisus scopari-us und/oder des Spartium junceum |
| 14 | Ramie | Faser aus dem Bast der Boehmeria nivea und der Boehmeria tenacissima |
| 15 | Sisal | Faser aus den Blättern der Agave sisalana |
| 16 | Sunn | Faser aus dem Bast der Crotalaria juncea |
| 17 | Henequen | Faser aus dem Bast der Agave fourcroydes |
| 18 | Maguey | Faser aus dem Bast der Agave cantala |
| 19 | Acetat | Faser aus Zellulose-Acetat mit weniger als 92 %, jedoch mindestens 74 % acetylierter Hydroxylgruppen |
| 20 | Alginat | Faser aus den Metallsalzen der Alginsäure |
| 21 | Cupro | Regenerierte Zellulosefaser nach dem Kupfer-Ammoniak-Verfahren |
| 22 | Modal | Nach einem geänderten Viskoseverfahren hergestellte regenerierte Zellulosefaser mit hoher Reißkraft und hohem Modul in feuchtem Zustand. Die Reißkraft (BC) in aufgemachtem Zustand und die Kraft (BM), die erforderlich ist, um in feuchtem Zustand eine Dehnung von 5 % zu erzielen, sind Folgende: BC (Zentinewton) ≥ 1,3 √ T + 2 T BM (Zentinewton) ≥ 0,5 √ T wobei T die mittlere längenbezogene Masse in Dezitex ist. |
| 23 | Regenerierte Proteinfaser | Faser aus regeneriertem und durch chemische Agenzien stabilisiertem Eiweiß |
| 24 | Triacetat | Aus Zellulose-Acetat hergestellte Faser, bei der mindestens 92 % der Hydroxylgruppen acetyliert sind |
| 25 | Viskose | Bei Endlosfasern und Spinnfasern nach dem Viskoseverfahren hergestellte regenerierte Zellulosefaser |
| 26 | Polyacryl (in der Verordnung, die im Amtsblatt der EU veröffentlicht worden ist, steht hier „Seide“ - es handelt sich sicher um ein redaktionelles Versehen, das noch behoben wird). | Faser aus linearen Makromolekülen, deren Kette aus mindestens 85 Gewichtsprozent Acrylnitril aufgebaut wird |
| 27 | Polychlorid | Faser aus linearen Makromolekülen, deren Kette aus mehr als 50 Gewichtsprozent chloriertem Olefin (z.B. Vinylchlorid, Vinylidenchlorid) |
| 28 | Fluorfaser | Faser aus linearen Makromolekülen, die aus aliphatischen Fluor-Kohlenstoff-Monomeren gewonnen werden |
| 29 | Modacryl | Faser aus linearen Makromolekülen, deren Kette aus mehr als 50 und weniger als 85 Gewichtsprozent Acrylnitril aufgebaut wird |
| 30 | Polyamid oder Nylon | Faser aus synthetischen linearen Makromolekülen, deren Kette sich wiederholende Amidbindungen aufweist, von denen mindestens 85 % anlineare aliphatische oder zykloaliphatische Einheiten gebunden sind |
| 31 | Aramid | Fasern aus linearen synthetischen Makromole-külen mit aromatischen Gruppen, deren Kette aus Amid- oder Imidbindungen besteht, von denen mindestens 85 % direkt an zwei aromatische Kerne gebunden sind und deren Imidbindungen, wenn vorhanden, die Anzahl der Amidbindungen nicht übersteigen darf |
| 32 | Polyimid | Faser aus synthetischen linearen Makromolekülen, deren Kette sich wiederholende Imideinheiten aufweist |
| 33 | Lyocell | Durch Auflösungs- und Spinnverfahren in organischem Lösungsmittel (Gemisch aus orga-nischen Chemikalien und Wasser) hergestellte regenerierte Zellulosefaser ohne Bildung von Derivaten |
| 34 | Polylactid | Faser aus linearen Makromolekülen, deren Kette zu mindestens 85 Masseprozent aus Milchsäureestereinheiten besteht, die aus natürlichvorkommenden Zuckern gewonnen werden, und deren Schmelzpunkt bei mindestens 135 °C liegt |
| 35 | Polyester | Faser aus linearen Makromolekülen, deren Kette zu mindestens 85 Gewichtsprozent aus dem Ester eines Diols mit Terephtalsäure besteht |
| 36 | Polyethylen | Faser aus gesättigten linearen Makromolekülen nicht substituierter aliphatischer Kohlenwasserstoffe |
| 37 | Polypropylen | Faser aus linearen gesättigten aliphatischen Kohlenwasserstoffen, in denen jeder zweite Kohlenstoff eine Methylgruppe in isotaktischer Anordnung trägt, ohne weitere Substitution |
| 38 | Polyharnstoff | Faser aus linearen Makromolekülen, deren Kette eine Wiederkehr der funktionellen Harnstoffgruppe (NH-CO-NH) aufweist |
| 39 | Polyurethan | Faser aus linearen Makromolekülen, deren Kette eine Wiederkehr der funktionellen Urethangruppen aufweist |
| 40 | Vinylal | Faser aus linearen Makromolekülen, deren Kette aus Polyvinylalkohol mit variablem Acetalisierungsgrad aufgebaut wird |
| 41 | Trvinyl | Faser aus drei verschiedenen Vinylmonomeren, die sich aus Acrylnitril, aus einem chlorierten Vinylmonomer und aus einem dritten Vinylmo-nomer zusammensetzt, von denen keines 50 % der Gewichtsanteile aufweist |
| 42 | Elastodien | Elastische Faser, die aus natürlichem oder synthetischem Polyisopren besteht, entweder aus einem oder mehreren polymerisierten Dienen, mit oder ohne einem oder mehreren Vinylmono-meren, und die, unter Einwirkung einer Zugkraft um die dreifache ursprüngliche Länge gedehnt, nach Entlastung sofort wieder nahezu in ihre Ausgangslage zurückkehrt |
| 43 | Elasthan | Elastische Faser, die aus mindestens 85 Gewichtsprozent von segmentiertem Polyuret-han besteht, und die, unter Einwirkung einer Zugkraft um die dreifache ursprüngliche Länge gedehnt, nach Entlastung sofort wieder nahezu in ihre Ausgangslage zurückkehrt |
| 44 | Glasfaser | Faser aus Glas |
| 45 | Elastomultiester | Faser, die durch die Interaktion von zwei oder mehr chemisch verschiedenen linearen Makro-molekülen in zwei oder mehr verschiedenen Phasen entsteht (von denen keine 85 % Gewichtsprozent übersteigt), die als wichtigste funktionale Einheit Estergruppen enthält (zu mindes-tens 85 %) und die nach geeigneter Behandlung um die anderthalbfache ursprüngliche Länge gedehnt, nach Entlastung sofort wieder nahezu in ihre Ausgangslage zurückkehrt |
| 46 | Elastolefin | Für Fasern aus mindestens 95 Gewichtsprozent Makromolekülen, zum Teil quervernetzt, zusammengesetzt aus Ethylen und wenigstens einem anderen Olefin, und die, unter Einwirkung einer Zugkraft um die anderthalbfache ursprüngliche Länge gedehnt, nach Entlastung sofort wieder nahezu in ihre Ausgangslage zurückkehren |
| 47 | Melamin | Faser, die zu mindestens 85 Gewichtsprozent aus quervernetzten, aus Melaminderivaten bestehenden Makromolekülen aufgebaut ist |
| 48 | Bezeichnung entsprechend dem Stoff, aus dem sich die Fasern zusammensetzen, z.B. Metall (metallisch, metallisiert), Asbest, Papier, mit oder ohne Zusatz „Faser“ oder „Garn“ | Fasern aus verschiedenen oder neuartigen Stoffen, die vorstehend nicht aufgeführt sind |
Textilerzeugnisse, die nicht mit einer Rohstoffgehaltsangabe versehen werden müssen
(Anhang V zur EU-Verordnung 1007/2011)
- Hemdsärmelhalter
- Armbänder für Uhren, aus Spinnstoffen
- Etiketten und Abzeichen
- Polstergriffe, aus Spinnstoffen
- Kaffeewärmer
- Teewärmer
- Schutzärmel
- Muffe, nicht aus Plüsch
- Künstliche Blumen
- Nadelkissen
- Bemalte Leinwand
- Textilerzeugnisse für Verstärkungen und Versteifungen
- Gebrauchte, konfektionierte Textilerzeugnisse, sofern sie ausdrücklich als solche bezeichnet sind
- Gamaschen
- Verpackungsmaterial, nicht neu und als solches verkauft
- Täschner- und Sattlerwaren, aus Spinnstoffen (z.B. Koffer, Taschen, Rucksäcke, Geldbörsen)
- Reiseartikel, aus Spinnstoffen (z.B. Schlafbrille, Nackenstützen für die Autofahrt)
- Fertige oder noch fertigzustellende handgestickte Tapisserien und Material zu ihrer Herstellung, einschließlich Handstickgarne, die getrennt vom Grundmaterial zum Verkauf angeboten werden und speziell zur Verwendung für solche Tapisserien aufgemacht sind (z.B. Wandteppiche)
- Reißverschlüsse
- Mit Textilien überzogene Knöpfe und Schnallen
- Buchhüllen aus Spinnstoffen
- Spielzeug
- Textile Teile von Schuhwaren
- Deckchen aus mehreren Bestandteilen mit einer Oberfläche von weniger als 500 cm²
- Topflappen und Topfhandschuhe
- Eierwärmer
- Kosmetiktäschchen
- Tabakbeutel aus Gewebe
- Futterale bzw. Etuis für Brillen, Zigaretten und Zigarren, Feuerzeuge und Kämme, aus Gewebe
- Hüllen für Mobiltelefone und tragbare Medienabspielgeräte mit einer Oberfläche von höchstens 160 cm²
- Schutzartikel für den Sport, ausgenommen Handschuhe
- Toilettenbeutel
- Schuhputzbeutel
- Bestattungsartikel
- Einwegerzeugnisse, ausgenommen Watte
- Den Vorschriften des Europäischen Arzneibuchs unterliegende Textilerzeugnisse, für die ein entsprechender Vermerk aufgenommen wurde, wieder verwendbare medizinische und ortho-pädische Binden und allgemeines orthopädisches Textilmaterial
- Textilerzeugnisse, einschließlich Seile, Taue und Bindfäden (vorbehaltlich Anhang VI Nummer 12), die normalerweise bestimmt sind:
a) zur Verwendung als Werkzeug bei der Herstellung und der Verarbeitung von Gütern;
b) zum Einbau in Maschinen, Anlagen (für Heizung, Klimatisierung, Beleuchtung usw.), Haushaltsgeräte und andere Geräte, Fahrzeuge und andere Transportmittel oder zum Betrieb, zur Wartung oder zur Ausrüstung dieser Geräte, mit Ausnahme von Planen und Textilzubehör für Kraftfahrzeuge, das getrennt von den Fahrzeugen verkauft wird - Textilerzeugnisse für den Schutz und die Sicherheit, wie z.B. Sicherheitsgurte, Fallschirme, Schwimmwesten, Not rutschen, Brandschutzvorrichtungen, kugelsichere Westen, besondere Schutzanzüge (z.B. Feuerschutz, Schutz vor Chemikalien oder anderen Sicherheitsrisiken) (z.B. auch Arbeitsschutzhandschuhe)
- Ballonhallen (Sport-, Ausstellungs-, Lagerhallen usw.), sofern Angaben über die Leistungen und technischen Einzelheiten dieser Erzeugnisse mitgeliefert werden
- Segel
- Textilwaren für Tiere
- Fahnen und Banner
Wichtig
Bitte beachte stets, dass dennoch die wesentlichen Merkmale, wie allgemeine Angaben zum Material, im Rahmen der Produktbeschreibung anzugeben sind.
 FAQ zum Textilkennzeichnungsgesetz
FAQ zum Textilkennzeichnungsgesetz
Welche Gesetze regelt die Textilkennzeichnung?
- Textilkennzeichnungsverordnung der Europäischen Union (Nr. 1007/2011): Die Verordnung harmonisiert die Bezeichnung verschiedener Textilien innerhalb des Binnenmarktes. Sie legt fest, wie Fasern zu bezeichnen sind.
- Textilkennzeichnungsgesetz: Das deutsche Textilkennzeichnungsgesetz (TextilKennzG) schlägt die Brücke zwischen der europäischen Textilkennzeichnungsverordnung und dem nationalen Recht: Es legt fest, dass Textilerzeugnisse nur dann in Umlauf gebracht werden dürfen, wenn sie entsprechend der Verordnung gekennzeichnet wurden. Außerdem regelt das TextilKennG die Folgen von Verstößen gegen die Verordnung.
Welche Artikel sind zu kennzeichnen, welche nicht?
Es sind alle Textilerzeugnisse zu kennzeichnen. Gemäß Art. 3 der EU-Verordnung Nr. 1007/2011 ist "Textilerzeugnis" ein Erzeugnis, das im rohen, halbbearbeiteten, bearbeiteten, halbverarbeiteten, verarbeiteten, halbkonfektionierten oder konfektionierten Zustand ausschließlich Textilfasern enthält, unabhängig von dem zur Mischung oder Verbindung angewandten Verfahren. Zu kennzeichnen sind ebenfalls:
- alle Erzeugnisse mit einem Gewichtsanteil an Textilfasern von mindestens 80 %
- Bezugsmaterial für Möbel, Regen- und Sonnenschirme mit einem Gewichtsanteil an Textilkomponenten von mindestens 80 %
- die Textilkomponenten der oberen Schicht mehrschichtiger Fußbodenbeläge, von Matratzenbezügen, von Bezügen von Campingartikeln, sofern diese Textilkomponenten einen Gewichtsanteil von mindestens 80 % dieser oberen Schichten oder Bezüge ausmachen
- Textilien, die in andere Waren eingearbeitet sind und zu deren Bestandteil werden, sofern ihre Zusammensetzung angegeben ist
Weitere Begriffsbestimmungen, z.B. zu Begriffen wie Textilfaser, Futter, Einwegartikel, findest du in Artikel 3 der EU-Verordnung
Die EU-Verordnung zur Textilkennzeichnung gilt nicht für:
- maßgeschneiderte Textilerzeugnisse, die von selbstständigen Schneidern für Verbraucher hergestellt wurden
- Textilerzeugnisse, die ohne Übereignung an Heimarbeiter oder selbstständige Unternehmen zur Weiterverarbeitung übergeben werden
- Des Weiteren sind die in Anhang V zur EU-Verordnung aufgeführten Textilerzeugnisse nicht zwingend zu kennzeichnen.
Wer muss die Textilerzeugnisse kennzeichnen?
Es handelt sich primär um eine Herstellerpflicht.
Art. 15 der EU-Verordnung Nr. 1007/2011 regelt hierzu:
"...Bringt ein Hersteller ein Textilerzeugnis in Verkehr, so stellt er die Etikettierung oder Kennzeichnung und die Richtigkeit der darin enthaltenen Informationen sicher. Ist der Hersteller nicht in der Union niedergelassen, so stellt der Einführer die Etikettierung oder Kennzeichnung und die Richtigkeit, der darin enthaltenen Informationen sicher...."
Der Händler sollte jedoch, bevor er die Textilerzeugnisse auf dem Markt bereitstellt kontrollieren, ob der Hersteller seine Pflichten aus der Textilkennzeichnungsverordnung ordnungsgemäß erfüllt hat. Der Händler wird aber wie ein Hersteller (mit allen entsprechenden Pflichten) behandelt, wenn er
-
- ein Erzeugnis unter seinem Namen oder seiner Handelsmarke in Verkehr bringt,
- das Etikett selbst anbringt oder
- den Inhalt des bereits angebrachten Etiketts ändert.
Wie hat die Kennzeichnung zu erfolgen?
Gemäß Art. 4 der EU-Verordnung sowie Art.1, §§ 3 und 4 TextilKennzG dürfen Textilerzeugnisse nur dann auf dem Markt bereitgestellt werden, wenn sie etikettiert oder gekennzeichnet sind. Gemäß Art. 5 der EU- Verordnung dürfen hierbei für die Beschreibung der Faserzusammensetzungen auf den Etiketten und Kennzeichnungen von Textilerzeugnissen ausschließlich die Textilfaserbezeichnungen nach Anhang I der EU-Verordnung verwendet werden. Die Angaben zur Faserzusammensetzung müssen zudem zutreffend sein. Des Weiteren gilt:
- Die Faserbezeichnungen nach Anhang I dürfen weder alleinstehend noch in Wortverbindungen oder als Eigenschaftswort für andere Fasern verwendet werden.
- Ergänzungen oder Erweiterungen der vorgeschriebenen Faserbezeichnungen durch Zusätze: z.B. Bio-Wolle oder Merinowolle sind unzulässig. Erlaubt ist hingegen 100 % Wolle (Merinowolle).
- Phantasie- und Markennamen (z.B. Tactel; Lycra, Spandex) sind allein keine zulässigen Angaben zur Textilfaserzusammensetzung - dürfen aber als zusätzliche Angaben ergänzt werden.
- Nur solche Textilerzeugnisse, die ausschließlich aus einer Faser bestehen, dürfen den Zusatz 100 %, rein oder ganz auf dem Etikett oder der Kennzeichnung tragen. Für andere Textilerzeugnisse dürfen diese oder ähnliche Formulierungen nicht verwendet werden.
- Auf dem Etikett oder der Kennzeichnung von Textilerzeugnissen sind die Bezeichnungen und Gewichtsanteile aller im Erzeugnis enthaltenen Fasern in absteigender Reihenfolge anzugeben, also z.B. "80 % Baumwolle 20 % Polyester" und nicht: "20 % Polyester 80 % Baumwolle".
- Als sonstige Fasern dürfen nur noch solche Fasern bezeichnet werden, deren Zusammensetzung zum Zeitpunkt der Herstellung schwierig zu bestimmen war und deren Anteil am Gesamtgewicht des Textilerzeugnisses lediglich bis zu 5 % beträgt.
- Bei Mehrkomponenten-Textilerzeugnissen (z.B. Anzug bestehend aus Ober- und Unterteil), deren Einzelkomponenten einen unterschiedlichen Textilfasergehalt haben, muss jede Komponente mit einem eigenen Etikett bzw. einer Kennzeichnung versehen sein, welche für die Komponenten den Textilfasergehalt angibt.
- Büstenhalter können ohne gesonderte Benennung des Schalengewebes als Gesamterzeugnis gekennzeichnet werden. (z.B.: ..% Polyamid, .. % Elasthan)
- Bei detaillierteren Angaben der Faserzusammensetzung muss eine vollständige Kennzeichnung erfolgen. D.h. das äußere und innere Gewebe der Schalenoberfläche sowie des Rückenteils ist anzugeben.
- Die Etikettierung und Kennzeichnung von Textilerzeugnissen muss dauerhaft, leicht lesbar, sichtbar, zugänglich und im Falle eines Etiketts fest angebracht sein.
- Die Verwendung von Abkürzungen ist bei der Textilkennzeichnung grundsätzlich nicht zulässig.
- Die Etikettierung oder Kennzeichnung darf nicht irreführend sein und muss so erfolgen, dass sie vom Verbraucher ohne Schwierigkeiten verstanden werden kann.
- Die Kennzeichnungspflicht für nichttextile Teile tierischen Ursprungs (z.B. aus Leder, Horn) in und am Textilerzeugnis mit der Angabe: "Enthält nichttextile Teile tierischen Ursprungs".
Eine umfassende Darstellung aller Regelungen der EU-Verordnung würde den Umfang dieses Überblicks sprengen - die neuen Regelungen im Detail findest du hier: Regelungen der EU-Verordnung
Was gilt beim Verkauf im Online-Handel?
Artikel 16 regelt: "Wird ein Textilerzeugnis auf dem Markt bereitgestellt, so werden die in den Artikeln 5, 7, 8 und 9 genannten Beschreibungen der Textilfaserzusammensetzung in Katalogen, in Prospekten, auf Verpackungen, Etiketten und Kennzeichnungen in einer Weise angegeben, dass sie leicht lesbar, sichtbar und deutlich erkennbar sind, sowie in einem Schriftbild, das in Bezug auf Schriftgröße, Stil und Schriftart einheitlich ist. Diese Informationen müssen für Verbraucher vor dem Kauf deutlich sichtbar sein; dies gilt auch für Fälle, in denen der Kauf auf elektronischem Wege erfolgt."
Du als Händler musst also sicherstellen, dass die Kunden die Textilkennzeichnungsangaben vor dem Kauf des Textilproduktes zur Kenntnis nehmen können. Die Angaben sollten daher direkt in die jeweiligen Artikelbeschreibungen bei den abgebildeten Produkten aufgenommen werden. Ist die Angabe erst durch eine weitere Verlinkung beispielsweise auf Details möglich, sollte bei den Abbildungen der Produkte auf der Hauptseite ausdrücklich darauf hingewiesen werden, wie der Verbraucher die Informationen erhält; z.B., indem beim Produkt die Angabe erfolgt: "Informationen zur Textilkennzeichnung finden Sie hier" oder "Für Informationen zur Textilkennzeichnung bitte auf Details klicken." Eine bloße Verlinkung auf beispielsweise Details – ohne einen solchen ausdrücklichen Hinweis – ist unzureichend und abmahngefährdet.
Was passiert, wenn Textilprodukte nicht entsprechend gekennzeichnet sind?
Ein Verstoß gegen die Textilkennzeichnungspflicht stellt gemäß Art.1, § 12 TextilKennzG eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße bis zu zehntausend Euro geahndet werden kann.
In welcher Sprache hat die Textilkennzeichnung zu erfolgen?
Gemäß Art. 16 der EU-Verordnung Nr. 1007/2011 erfolgt die Kennzeichnung grundsätzlich in der Amtssprache oder den Amtssprachen des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet die Textilerzeugnisse dem Verbraucher bereitgestellt werden, es sei denn, der betreffende Mitgliedstaat schreibt etwas anderes vor. Textilprodukte, welche den deutschen Verbrauchern bereitgestellt werden, sind also in deutscher Sprache zu kennzeichnen. Dies macht auch Artikel 1, § 4 TextilKennzG deutlich. Entsprechend sollten dann auch die Angaben im Online-Angebot in deutscher Sprache erfolgen.
Ausnahme: Wird Nähgarn, Stopfgarn oder Stickgarn, das auf Spulen, Fadenrollen, in Strähnen, Knäueln oder sonstigen kleinen Einheiten angeboten wird, einzeln verkauft, so können sie in einer beliebigen Amtssprache der Organe der Union etikettiert oder gekennzeichnet sein, sofern sie auch eine globale Etikettierung aufweisen.
Ist die Pflegekennzeichnung von Textilien gesetzlich vorgeschrieben?
Ja und Nein. Angaben hierzu sind grundsätzlich in Deutschland freiwillig, dennoch werden Angaben zur Waschbarkeit unter Umständen als wesentliches Merkmal für die Produktbeschreibung angesehen.
Müssen Online-Händler künftig die Hersteller der Textilerzeugnisse im Online-Angebot nennen?
Sofern die Textilprodukte sich als "Verbraucherprodukte" im Sinne des Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) einordnen lassen, müssen gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 2 ProdSG der Name und die Kontaktanschrift des Herstellers oder, sofern dieser nicht im Europäischen Wirtschaftsraum ansässig ist, der Name und die Kontaktanschrift des Bevollmächtigten oder des Einführers am Produkt angebracht sein. Eine darüber hinausgehende Verpflichtung, diese Informationen dem Verbraucher bereits vor Vertragsschluss zur Verfügung zu stellen, bestand bislang nicht. Allerdings ändert sich das. Ab dem 13.12.2024 gilt die neue Produktsicherheitsverordnung. Die Angabe unter anderem der Herstelleradressen in der Produktbeschreibung ist spätestens dann Pflicht.
War dieser Ratgeber hilfreich?
Das könnte dich auch interessieren