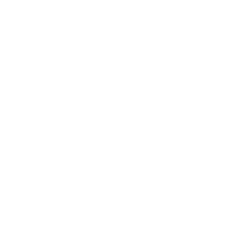Was ist Geoblocking?
Es handelt sich um eine von Online-Verkäufern angewandte Praxis, bei der einem Verbraucher aus dem Mitgliedstaat B, ohne seine vorherige Zustimmung, der Zugang zu einer Website aus Mitgliedstaat A verwehrt wird oder der auf eine andere Version der Website (d.h. lokale Version) weitergeleitet wird. Dazu gehören auch Situationen, in denen der Verbraucher aus Mitgliedstaat A Zugang zu einer Website erhält, der Verbraucher aus Mitgliedstaat B jedoch nicht in der Lage ist, den Kauf abzuschließen oder mit einer Debit- oder Kreditkarte aus einem bestimmten Land (z.B. Mitgliedstaat A) zu bezahlen.
Beispiel
Simone aus Frankreich will sich ein Kleid in einem polnischen Webshop kaufen. Sie kann jedoch nicht auf den polnischen Webshop zugreifen oder wird ohne ihre Zustimmung auf eine französische Version der Website weitergeleitet. Simone unterliegt dem Geoblocking.
Der EU-Rat spricht beim Geoblocking von einer Form der Diskriminierung. Online-Kunden werden daran gehindert, Dienstleistungen oder Waren von Webseiten zu beziehen, deren Standort in einem anderen Land ist. In der Vergangenheit kam es nicht nur zur Sperrung von Inhalten, wenn User aus anderen Ländern zugreifen wollten, sondern es kam auch zu Benachteiligungen in Bezug auf Preis-, Verkaufs- und Zahlungsbedingungen. So musste beispielsweise ein italienischer Online-Kunde auf einer französischen Webseite für einen Freizeitpark einen höheren Ticketpreis bei der Onlinebuchung bezahlen, als ein französischer User.
Beispiel für Geoblocking aufgrund der IP-Adresse:
Ein Deutscher möchte auf eine französische Shop-Seite zugreifen. Es erscheint der Text: "Dieser Service ist in deinem Land leider nicht verfügbar." Aber auch hier liegt ein Geoblocking vor: Ein Deutscher wird beim Versuch eine fr-Domain zu laden, ungefragt auf die de-Domain weitergeleitet.
Beispiel für Behinderung beim Tätigen des Bestellvorgangs:
Ein Deutscher füllt seinen Warenkorb auf einer französischen Shop-Seite. Er wählt als Bezahlmethode das Lastschriftverfahren. Bei der Eingabe der IBAN kann er sein deutsches Konto nicht angeben, da eine IBAN mit dem Länderkürzel FR voreingestellt ist. Anderes Beispiel: Der Deutsche kann bei der Rechnungsadresse nur französische Wohnanschriften angeben.
Ziel der Verordnung
Die Verordnung (EU) 2018/302 und das Verbot von Geoblocking verhindern Benachteiligungen und Diskriminierung bei Online-Käufen. Staatsangehörigkeit, Wohnort oder Ort der Niederlassung innerhalb des Binnenmarktes haben keine Auswirkungen mehr auf den Online-Handel.
Um dieses Ziel zu erreichen, sind durch die Verordnung verschiedene Pflichten für Online-Händler und Webseiten-Betreiber festgesetzt wurden.
Pflichten für Online-Händler
a) Gleicher Zugang
Nach der neuen EU-Verordnung ist es Online-Händlern und Webseitenbetreibern in Bezug auf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, einschließlich Preisen, nicht mehr erlaubt, Kunden unterschiedlich zu behandeln. Dies gilt in folgende Situationen:
- Wenn der Händler Waren anbietet, die entweder in einen Mitgliedstaat geliefert werden, weil der Händler die Lieferung dorthin anbietet oder die an einem Ort abgeholt werden, der mit dem Kunden vereinbart wurde
- Wenn der Händler elektronische Dienstleistungen anbietet und erbringt. Dazu zählen u. a. Cloud-Dienste, Data-Warehousing, Webhosting oder die Bereitstellung von Firewalls
- Wenn der Händler Dienstleistungen erbringt, die der Kunde in dem Land erhält, indem der Händler tätig ist, beispielsweise Hotelübernachtungen oder Autovermietungen
Wichtig
Wenn Waren in bestimmte Mitgliedstaaten nicht zugestellt werden können, dürfen Online-Händler den Verkauf von Produkten an ausländische Kunden nicht verweigern. Das heißt: Wenn ein niederländischer Kunde ein günstiges Produkt bei einem Leipziger Online-Händler findet, der allerdings keinen grenzüberschreitenden Versand anbietet, muss der Kunde die Lieferung eigenständig organisieren. Für den Händler besteht nur Lieferpflicht in die Mitgliedstaaten, die in seinen AGBs aufgeführt sind.
b) Zahlungsvorgänge
Die Geoblocking-Verordnung verbietet ungerechtfertigte Ungleichbehandlungen bzgl. der Zahlungsmethoden bei Kunden aufgrund der Staatsangehörigkeit, des Wohnsitzes oder des Ortes der Niederlassung. Es ist nicht gestattet aufgrund der genannten Gründe verschiedene Zahlungsbedingungen anzuwenden.
c) Nichtdiskriminierung beim Zugang von Webseiten
Webseitenbetreibern oder Online-Händlern ist es nicht gestattet Kunden aufgrund der Staats- angehörigkeit, des Wohnsitzes oder des Ortes der Niederlassung den Zugang zur eigenen Webseite zu beschränken oder zu sperren.
Zudem ist es seit der Verordnung verboten Kunde aufgrund ihrer IP-Adresse automatisch zu länderspezifischen Webseiten weiterzuleiten. So ist es beispielsweise nicht mehr erlaubt, dass ein italienischer Kunde, der auf einer deutschen Webseite etwas kaufen möchte, automatisch weitergeleitet auf die italienische Version des Shops wird. Also wenn der User bspw. www.testdomain.de eingibt, darf er nicht automatisch weitergeleitet werden auf www.testdomain.it.
Der Kunde muss zwingend auf die Seite geleitet werden, die er eingegeben hat. Danach muss er selbst entscheiden können, ob er auf der deutschen Webseite weitersurfen möchte oder ob er die italienische Webseite bevorzugt
d) Passive Verkaufsgeschäfte
Das Ziel der EU ist es nicht Händler durch die Verordnung dazu zu verpflichten, gezielt Handel in andere Mitgliedstaaten zu betreiben. Es besteht auch keine Verpflichtung, dass Händler vielsprachige Webseiten anbieten und somit sämtliche europäische Rechtsordnungen berücksichtigen. Ziel ist es vielmehr Beschränkungen des passiven Verkaufs zu beseitigen. Unter einem passiven Verkauf werden Verkäufe als Reaktionen auf Bestellungen verstanden, um die sich der Anbieter nicht aktiv bemüht hat, also nicht gezielt Kunden ansprechen.
Ausnahmen
Womit sich die Europäische Kommission noch befassen wird, sind Dienstleistungen im Zusammenhang mit urheberrechtlich geschützten Inhalten oder Werken, die nicht in physischer Form vorliegen. Dazu zählen u. a. Musik-Streaming-Dienste oder E-Books. Diese fallen bisher nicht unter die Verordnung.
Des Weiteren sind auch Dienstleistungen in Bereichen wie Finanzen, Verkehr, audiovisuelle Medien, Gesundheitswesen und Soziales ausgenommen.
Auch steht es Anbietern weiterhin frei, unterschiedliche Allgemeine Geschäftsbedingungen, einschließlich der Preise, anzubieten und bestimmte Kundengruppen gezielt anzusprechen, denn im Gegensatz zu Preisdiskriminierung wird die Preisdifferenzierung nicht verboten.
Wissenswertes zur Geoblicking-Verordnung
Was ist der Zweck der Geoblocking-Verordnung?
Sie zielt darauf ab, die ungerechtfertigte Diskriminierung des Verbrauchers aufgrund seiner Staatsangehörigkeit, seines Wohnsitzes oder seiner Niederlassung zu beenden und damit Verbrauchern und Unternehmen innerhalb der EU mehr Möglichkeiten für grenzüberschreitende Einkäufe von Waren und Dienstleistungen zu geben.
Deckt die Verordnung nur Käufe durch Verbraucher ab?
Nein, die Verordnung spricht nicht von Verbrauchern, sondern von Kunden. Kunden können hier auch Unternehmen sein, sofern sie Produkte erwerben, die nicht für den Weiterverkauf gedacht sind, also zum Beispiel Büromaterialien.
Müssen Online-Händler die Preise für Waren in allen EU-Ländern harmonisieren?
Nein. Für physische Waren sind Online-Händler nicht verpflichtet, die Preise für ihre verschiedenen Online-Shops in verschiedenen Ländern zu harmonisieren. Das bedeutet, dass es ihnen freisteht, Produkte zu unterschiedlichen Preisen in verschiedenen Staaten und auch in verschiedenen Vertriebskanälen anzubieten.
Besondere Beachtung kommt aber der sogenannten Buchpreisbindung zu. Ein deutscher Online-Händler, der in Deutschland der Buchpreisbindung unterliegt, muss das Buch in seinem deutschen Online-Shop zu dem vorgegebenen Preis anbieten. Er darf aber das gleiche Buch in seinem holländischen Shop zu einem anderen, auch höheren Preis anbieten, als in seinem deutschen Online-Shop. Dem Online-Händler ist es hingegen nicht erlaubt, den holländischen Verbraucher zu diskriminieren, wenn der holländische Verbraucher in seinem deutschen Online-Shop das gleiche Buch zu dem in Deutschland angebotenen (niedrigeren) Preis erwerben will.
Wie sieht es aus mit Sonderaktionen?
Händler dürfen auf unterschiedlichen Seiten unterschiedliche Rabattaktionen anbieten. Es liegt auf der Hand, dass ein Rabatt zum französischen Nationalfeiertag auf der polnischen Shopseite schlicht und einfach keinen Sinn ergeben würde. Der polnische Kunde kann aber dadurch, dass er nicht am Shoppen auf der französischen Seite gehindert werden darf, dennoch von den günstigen Angeboten profitieren. Er muss im Zweifel aber selber eine Lösung für den Transport finden, wenn auf der französischen Seite keine Lieferung nach Polen angeboten wird.
Was bedeutet Geoblocking für den Zugriff auf Webseiten von Online-Webshops?
Die Verordnung hindert Online-Händler daran, den Zugang zu ihrer Website für Verbraucher aus einem anderen EU-Land zu sperren. Darüber hinaus wird verhindert, dass Online-Händler den Verbraucher ohne seine vorherige Zustimmung auf eine lokale Website umleitet. Wenn beispielsweise ein Online-Händler eine portugiesische und eine spanische Website hat und ein portugiesischer Verbraucher die spanische Website anstelle der portugiesischen besuchen möchte, darf der Online-Händler den portugiesischen Verbraucher nur dann auf die portugiesische Website umleiten, wenn er zuvor seine ausdrückliche Zustimmung über einen Opt-in-Mechanismus eingeholt hat. Außerdem muss die spanische Website für den portugiesischen Verbraucher leicht zugänglich bleiben, selbst wenn der Verbraucher seine Zustimmung gibt, auf die portugiesische Website weitergeleitet zu werden.
Die Zustimmung des Verbrauchers umgeleitet zu werden, muss der Online-Händler im Streitfall nachweisen. Dies kann er tun, indem er z.B. nachweist, dass sein Shop-System so arbeitet, dass es die Umleitung des Verbrauchers generell nur zulässt, wenn dieser zugestimmt hat, oder der Online-Händler holt sich den Nachweis ein, in dem er bei Klick auf "ok" einen Log setzt und die Zustimmung darüber protokolliert.
Muss ich sicherstellen, dass der Kunde sein Produkt auch benutzen kann?
Nein. Folgendes Szenario: Ein Spanier kauft bei einem deutschen Händler, der keine Lieferung nach Spanien anbietet, ein technisches Gerät. Nachdem der Spanier den Transport selbst organisiert hat, stellt er fest, dass das Gerät nicht den technischen Anforderungen in Spanien entspricht. Er kann es in der Folge nicht nutzen. Hier hat der Kunde das Nachsehen. Da der Händler sein Geschäft gar nicht nach Spanien ausgerichtet hat, also es eigentlich gar nicht auf spanische Kunden abgesehen hat, muss er auch nicht sicherstellen, dass der Kunde das Gerät tatsächlich nutzen kann. Das gleiche gilt auch für den Fall, dass der Kunde die Ware gar nicht erst in sein Land einführen darf und sie daher beim Zoll hängen bleibt.
Welche Adressen müssen Kunden eingeben können?
Eine Lieferpflicht besteht zwar nicht, allerdings muss jeder Kunde aus dem Europäischen Wirtschaftsraum in jedem Online-Shop einkaufen können. Da auf eine Rechnung immer die Wohnanschrift des Kunden gehört, muss bei der Rechnungsadresse die Eingabe jeder Adresse aus dem Europäischen Wirtschaftsraum möglich sein. Die Eingabe der Lieferadresse kann allerdings auf die Länder, in die der Händler versendet, beschränkt werden.
Muss ich Abholstellen für Kunden einrichten, für die ich keinen Versand anbiete?
Nein! Hier gilt dasselbe, wie beim Versand: Ich bin nicht verpflichtet, eine Abholung für Kunden zu ermöglichen, die nicht im Liefergebiet leben. Biete ich aber ohnehin eine Abholmöglichkeit an, so muss ich diese für alle Kunden im Europäischen Wirtschaftsraum anbieten.
Was ändert sich nun also konkret in meinem Shop?
In erster Linie dürfen Händler und Händlerinnen nun keine Kunden mehr aufgrund der länderspezifischen IP-Adresse aussperren. Außerdem müssen sie gewährleisten, dass bei der Rechnungsadresse die Eingabe jeder Wohnanschrift aus dem Europäischen Wirtschaftsraum möglich ist.
Sollte die ausdrückliche Zustimmung zur Weiterleitung auf eine lokale Website jedes Mal erteilt werden, wenn ein Kunde eine Website besucht?
Wenn ein Kunde (z.B. aus Österreich) bereits seine Zustimmung gegeben hat, auf eine lokale Website (z.B. österreichische Version der Website) weitergeleitet zu werden, ist es nicht notwendig, seine Zustimmung erneut einzuholen, wenn er versucht, auf die Website (z.B. deutsche Version der Website) zu einem anderen Zeitpunkt zuzugreifen. Die Website, auf die der Kunde ursprünglich zugreifen wollte (z.B. die deutsche Version der Website), muss jedoch leicht zugänglich bleiben. Der Kunde kann seine Zustimmung zur Weiterleitung (z.B. auf die österreichische Version der Website) jederzeit gegenüber dem Online-Händler widerrufen.
Was ist mit den Zahlungen? Müssen Händler alle Zahlungsmethoden aus anderen EU-Ländern akzeptieren?
Online-Händlern steht es weiterhin frei festzulegen welche Zahlungsmittel sie akzeptieren. Jedoch werden mit der Verordnung spezifische Regeln für die Nichtdiskriminierung im Bereich der von ihnen akzeptierten Zahlungsmittel eingeführt. Jedoch werden mit der Verordnung spezifische Regeln für die Nichtdiskriminierung im Bereich der von ihnen akzeptierten Zahlungsmittel eingeführt. Sie gilt für Fälle, in denen die Ungleichbehandlung aufgrund der Staatsangehörigkeit des Verbrauchers, des Wohnsitzes oder des Niederlassungsortes, des Ortes des Zahlungskontos, des Niederlassungsortes des Zahlungsdienstleisters oder des Ausstellungsortes des Zahlungsinstruments erfolgt. Eine differenzierte Behandlung ist verboten, wenn diese drei Voraussetzungen gem. Artikel 5 (1) a) -c) erfüllt sind:
- Zahlungen erfolgen durch elektronische Transaktionen per Überweisung, Lastschrift oder kartenbasiertes Zahlungsinstrument innerhalb der gleichen Marke und Kategorie; D.h. Anbieter eines kartengebundenen Zahlungsinstrumentes einer best. Marke und Kategorie sind nicht verpflichtet, Karten einer anderen Marke, die der selben Kategorie kartengebundener Zahlunginstrumente angehören, oder andere Kategorien von Karten derselben Marke zu akzeptieren.
Beispielsweise ist der Anbieter einer Debitkarte der Marke X nicht verpflichtet, Kreditkarten dieser Marke X zu akzeptieren. Anbieter, die Verbraucherkreditkarten der Marke X akzeptieren, müssen keine Firmenkreditkarten der Marke X annehmen. - Die Authentifizierungsanforderungen sind erfüllt;
- Die Zahlungen erfolgen in einer Währung, die der Händler akzeptiert.
Müssen Händler alle nationalen Debitkarten aus anderen EU-Ländern akzeptieren?
Nein. Die Verordnung legt lediglich fest, dass Online-Händler nicht aufgrund des Mitgliedstaats, in dem eine Kredit- oder Debitkarte ausgestellt wird, diskriminieren dürfen. Innerhalb einer bestimmten Zahlungsmarke und/oder -kategorie darf aber abgelehnt werden, wenn diese Marke / Kategorie vom Händler nicht angeboten wird.
Inwieweit fallen Online-Marktplätze unter die Verpflichtungen dieser Verordnung?
Diese Verordnung gilt gleichermaßen für alle in der Union tätigen Wirtschaftsbeteiligten, einschließlich der Online-Marktplätze
Was bedeutet Geoblocking für den Verkauf von nicht elektronischen Dienstleistungen an einem bestimmten physischen Standort?
Will ein Kunde aus einem Mitgliedstaat eine Dienstleistung am Ort des Gewerbetreibenden in einem anderen Mitgliedstaat kaufen, so muss er diese Dienstleistung ohne jegliche Diskriminierung erwerben können.
Wenn beispielsweise eine finnische Familie eine Sommerunterkunft in Griechenland mieten möchte, muss sie dies zu den gleichen Bedingungen wie griechische Familien tun dürfen. Das bedeutet, es darf keine Preisunterschiede zwischen ausländischen und einheimischen Verbrauchern bei Buchung von z.B. Hotelunterbringung, Sportveranstaltungen, Autovermietung, Eintrittskarten für Festivals, Ausstellungen, Sehenswürdigkeiten oder Freizeitpark im Land des Anbieters über die gleiche Webseite geben.
Welche anderen Sektoren fallen nicht unter die Verordnung?
Dienstleistungen im Bereich Verkehr und Finanzdienstleistungen für Privatkunden werden ebenfalls nicht erfasst.
Unter welchen Umständen wäre Geoblocking gerechtfertigt?
Unter manchen Bedingungen dürfen Händler auch weiter Geoblocking betreiben. Manchmal ist Geoblocking nämlich einfach notwendig, um Gesetze einzuhalten. Unter diesen Umständen ist es auch gerechtfertigt.
Erlaubtes Geoblocking wegen Buchpreisbindung
Ein Händler hat seinen Online-Shop auf Deutschland und Österreich ausgerichtet. Österreichische und deutsche Kunden können beide auf der gleichen Seite shoppen. Da in Österreich aber eine andere Buchpreisbindung gilt, erkennt die Shopseite an Hand der IP-Adresse, woher der Kunde kommt und passt die Preise automatisch an.
Erlaubtes Geoblocking wegen nationalen Verboten
Eine Händlerin bietet online europaweit verschiedene Waffen an. Unter anderem bietet sie ein breites Sortiment an Pfeffersprays an. Dieses Sortiment wird Besuchern mit niederländischer IP-Adresse gar nicht erst angezeigt, da Pfeffersprays dort verboten sind.
Welche Rechtsvorschriften finden Anwendung?
Bestellt ein Kunde, der nicht im Liefergebiet lebt, finden die Gesetze des Händlers Anwendung. Nationale Vorschriften anderer Länder werden erst dann relevant, wenn der Händler sein Geschäft auf ein anderes Land ausrichtet, also beispielsweise eine Lieferung in ein anderes Land anbietet.
Ist eine Anpassung der Rechtstexte des Händlerbund erforderlich?
Ja. Sie müssen in Ihrem Online-Shop im Rahmen der Datei "Zahlung und Versand" definieren, in welche Zielländer Sie liefern und welche Zahlungsarten Sie für Kunden anbieten möchten. Eine Unterscheidung der Zahlarten für das In-und EWR- Ausland (EU-Mitgliedsstaaten + Norwegen, Island, Lichtenstein) ist nicht mehr möglich.
Mit unseren Newslettern bist du jederzeit auf dem Laufenden – sowohl in Sachen Online-Handel als auch bei Amazon, der Logistik oder der digitalen Tech-Branche. Neben aktuellen Entwicklungen und News versorgen wir dich auch mit Hintergründen, Rechtsurteilen und wertvollen Tipps und Tricks.

Geschrieben von
Volljuristin Sandra May
War dieser Ratgeber hilfreich?