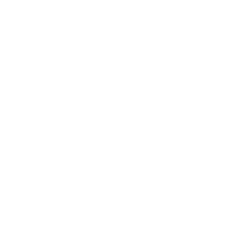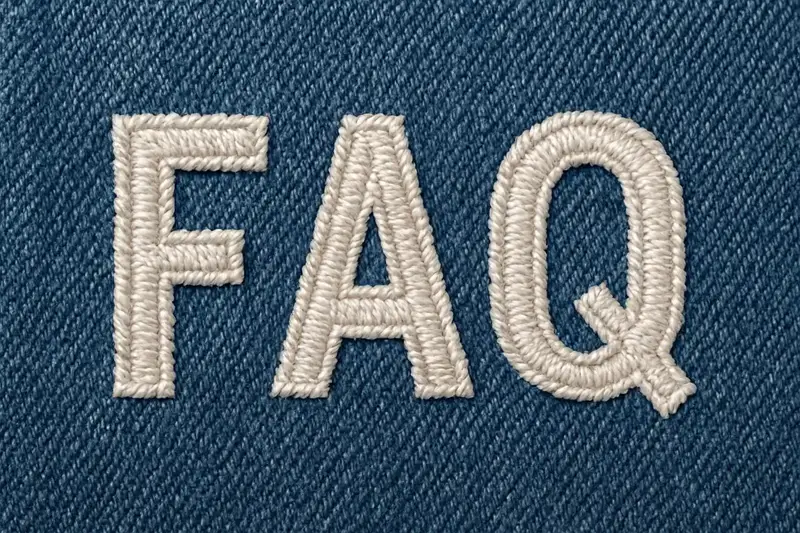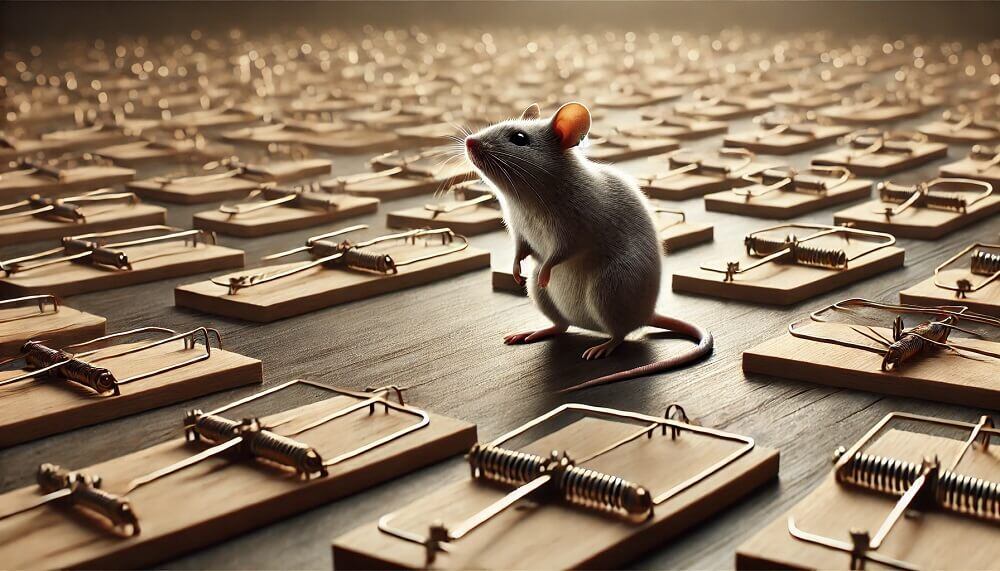In diesem FAQ zum Textilkennzeichnungsgesetz erfährst du durch Beispiele aus der Praxis, wie du die Herausforderungen meisterst.
1. Welche Angaben für Bekleidung muss ich im Online-Shop für Bekleidung mindestens auflisten, um die Textilkennzeichnung und Produktsicherheit zu erfüllen?
- Produktbeschreibung
- Größe & Passform
- Material & Pflegehinweise (z. B. 95 % Baumwolle, 5 % Elasthan; Waschen bei 30 °C etc.)
- Übersicht über zulässige Textilfaserbezeichnungen (EU-Verordnung Nr. 1007/2011)
- Herstellerangaben (Name, Adresse, Kontakt-E-Mail)
2. Genügt auch ein Hangtag mit Etikettierpistole?
Ein Hangtag allein reicht nicht aus. Die Angaben sollten entweder aufgedruckt (z. B. auf der Innenseite) oder auf einem fest vernähten Etikett angebracht werden. Nur wenn sich das Produkt nicht dauerhaft kennzeichnen lässt – etwa bei Trinkgläsern oder empfindlichen Materialien – darf die Kennzeichnung ersatzweise auf der Verpackung oder der Beilage erfolgen.
3. Reicht es aus, wenn man auf dem Etikett eine Internetseite angibt, auf der die Informationen sind?
Nein, das genügt in der Regel nicht. Der Name und die postalische Anschrift des verantwortlichen Herstellers oder Importeurs muss direkt auf dem Produkt oder seinem Etikett angegeben werden.
4. Ich kaufe Kleidung im Großhandel ein und verändere sie mit Plotterfolien oder Druckfarben. Bin ich damit Hersteller?
Wenn du Kleidung im Großhandel einkaufst und sie anschließend mit Plotterfolien oder Druckfarben veredelst, wirst du nicht automatisch zum Hersteller im rechtlichen Sinn. Entscheidend ist, ob du das Produkt wesentlich veränderst oder ein neues Risiko schaffst.
5. Muss die Textilkennzeichnung bereits bei der Einfuhr aus einem Nicht-EU-Land angebracht sein, oder genügt es, wenn sie vor dem Verkauf ergänzt wird?
Die Kennzeichnung muss nicht schon beim Import vorhanden sein. Entscheidend ist, dass sie vor dem Inverkehrbringen – also bevor die Ware in der EU verkauft oder angeboten wird – vollständig und korrekt angebracht ist. Das bedeutet: Du kannst die Etiketten nach dem Import in Deutschland anbringen, solange die Produkte erst danach an Kunden abgegeben werden.
6. Müssen Warnhinweise im Produkt eingenäht sein oder reicht ein Hinweis auf der Verpackung?
Warnhinweise sind – anders als Pflegehinweise – nicht immer verpflichtend, werden aber wichtig, wenn sie für die sichere Nutzung des Produkts erforderlich sind. Im Idealfall sollten solche Hinweise direkt am Produkt angebracht oder eingenäht werden, damit sie dauerhaft sichtbar bleiben. Ist das technisch oder praktisch nicht möglich, kann der Hinweis alternativ auf der Verpackung oder in einer beiliegenden Information erfolgen. Entscheidend ist, dass der Verbraucher den Warnhinweis vor oder bei der Nutzung eindeutig erkennen kann.
7. Ist eine Postfach-Adresse auf dem Pflegeetikett zulässig oder muss die gleiche Adresse wie im Impressum angegeben werden?
Eine Postfach-Adresse reicht nicht aus. Auf dem Pflegeetikett muss eine ladungsfähige Anschrift angegeben sein – also eine physische Geschäftsadresse, unter der der Hersteller oder Importeur tatsächlich erreichbar ist. Diese muss nicht identisch mit der Impressumsadresse des Online-Shops sein, aber sie muss eine Kontaktaufnahme und Zustellung von Schreiben ermöglichen. Der Hintergrund: Verbraucher und Behörden müssen den Verantwortlichen im Bedarfsfall eindeutig erreichen können.
8. In welcher Sprache muss die Kennzeichnung erfolgen?
In der Amtssprache des Mitgliedstaates, in dem du an Verbraucher verkaufst – in Deutschland auf Deutsch.
9. Wie kennzeichne ich Mischgewebe korrekt?
In Gewichtsprozent und absteigend (z. B. 60 % Baumwolle, 40 % Polyester). Sammelbezeichnung „Andere Fasern“ ist in engen Grenzen zulässig (geringe Anteile/technisch bedingte Beimischungen).
10. Wie muss ein Hut aus 100 % Raffia auf dem Textilkennzeichnungsetikett angegeben werden? Reicht die Angabe „100 % Raffia“ aus?
Raffia (Bastfasern aus der Raffiapalme) zählt grundsätzlich zu den pflanzlichen Fasern und kann damit unter die Textilkennzeichnungspflicht fallen. Allerdings ist „Raffia“ nicht als Faserbezeichnung in der EU-Textilkennzeichnungsverordnung gelistet. Daher sollte geprüft werden, ob eine vergleichbare zugelassene Faserbezeichnung verwendet werden kann oder ob eine Einzelfallauskunft beim Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit einzuholen ist.
11. Muss ich bei gestrickter/gehäkelter Kleidung, Taschen oder Deko (mit Fasern wie Polyacryl, Polyester, Modal, Baumwolle etc.) ein Label „leicht entflammbar“ oder ein Gefahrensymbol anbringen?
Bei solchen Textilprodukten gibt es keine generelle Pflicht zu „leicht entflammbar“-Labels oder Gefahrensymbolen. Nach der Produktsicherheitsverordnung (GPSR) musst du jedoch Warn- und Sicherheitshinweise geben, wenn die Risikobewertung zeigt, dass bei üblicher Nutzung ein relevantes Brandrisiko besteht. Werden die Produkte typischerweise nahe offener Flammen verwendet (z. B. Tischdekoration zu Weihnachten, Decke/ Poncho am Lagerfeuer), ist ein klarer Hinweis empfehlenswert, um das Risiko zu minimieren.
12. Müssen bei Elektroartikeln wie Heizdecken, Heizkissen oder Massagegeräten mit Stoffbezug die Textilzusammensetzungen angegeben werden?
Für Heizdecken und Heizkissen ist die Angabe der Textilzusammensetzung verpflichtend, da es sich um Textilprodukte im Sinne der Textilkennzeichnungsverordnung handelt. Bei Massagegeräten oder anderen Elektroartikeln mit einem fest verbauten Stoffbezug gilt die Kennzeichnungspflicht nur dann, wenn der textile Teil eigenständig wahrnehmbar ist – also etwa abnehmbar oder austauschbar. Ist der Stoff lediglich fest verbaut und kein eigenständiger Bezug, muss keine Textilkennzeichnung erfolgen.
13. Welche Folgen drohen bei Verstößen?
Marktüberwachungsmaßnahmen, Bußgelder und sogar eine Abmahnung der Textilkennzeichnung können möglliche Folgen sein. Online kann schon eine fehlende/irreführende Angabe abmahnbar sein.
14. Ich kaufe die Kleidung im Großhandel ein und verändere sie mit Plotterfolien oder Druckfarben. Muss ich das ursprüngliche Etikett entfernen oder ergänzen?
Wenn du Kleidung aus dem Großhandel veränderst – etwa durch Plotterfolien oder Druckfarben –, musst du das ursprüngliche Etikett nicht entfernen. Es darf bestehen bleiben, solange die Materialzusammensetzung der Textilien durch deine Veränderung nicht wesentlich verändert wird. Du kannst zusätzlich ein eigenes Etikett mit deinen Kontaktdaten anbringen, um klarzustellen, dass du die Veredelung vorgenommen hast. Achte aber darauf, dass das neue Etikett nicht irreführend ist und die ursprünglichen Angaben nicht überdeckt oder verfälscht.
15. Ich upcycle gebrauchte Jeansjacken mit Borten und Stickereien – fallen die Borten unter die 5 %, die nicht angegeben werden müssen?
Bei upcycelten Textilien wie veredelten Jeansjacken kommt es auf den Anteil der neu hinzugefügten Materialien an. Grundsätzlich gilt: Die Hauptbestandteile müssen mit ihrer Textilfaserzusammensetzung angegeben werden. Borten, Stickereien oder Verzierungen, die unter 5 % des Gesamtgewichts liegen, können nach der Textilkennzeichnungsverordnung ausgenommen sein, sofern sie nur dekorativen Charakter haben.
Da die Beurteilung im Einzelfall von der Art und Menge der Veränderungen abhängt, empfiehlt sich eine Einzelfallprüfung oder rechtliche Beratung, um die Kennzeichnung korrekt vorzunehmen.
16. Kann ich bei selbstgenähten Taschen statt eines Einnähetiketts auch ein Papieretikett mit meinen Herstellerangaben einkleben, oder muss die Kennzeichnung fest angebracht sein?
Die Herstellerkennzeichnung muss grundsätzlich direkt am Produkt angebracht und dauerhaft lesbar sein. Ein Papieretikett gilt in der Regel nicht als ausreichend, da es sich beim Waschen oder durch Nutzung leicht löst. Nur wenn eine feste Kennzeichnung technisch nicht möglich oder unzumutbar ist, darf ausnahmsweise auf andere Lösungen ausgewichen werden.
17. Ich nähe handgefertigte Anhänger oder kleine Figuren aus Filz und verschiedenen Stoffresten. Müssen diese Produkte mit der prozentualen Zusammensetzung der Materialien gekennzeichnet werden – und wie gebe ich „Filz“ an, wenn dieser gar nicht in der Liste der zulässigen Textilbezeichnungen steht?
Filz ist keine eigene Faserart, sondern eine Verarbeitungsform verschiedener Fasern – zum Beispiel aus Wolle, Baumwolle oder Viskose. Deshalb darf „Filz“ nicht als Faserbezeichnung angegeben werden. Stattdessen muss die tatsächliche Faserzusammensetzung genannt werden, also z. B. „100 % Wolle“ oder „70 % Viskose, 30 % Polyester“.
18. Müssen bei geflochtenen Armbändern aus Satinbändern oder bei Untersetzern Etiketten mit Materialangabe angebracht werden?
Ob eine Textilkennzeichnungspflicht besteht, hängt davon ab, wie das Produkt verwendet wird. Wenn die Artikel als Modeaccessoire oder Haushaltsware mit textilem Charakter gelten, müssen sie in der Regel eine Faserzusammensetzung ragen.
19. Wie muss recycelte Wolle mit einem Anteil von 80–92 % Wolle und dem Rest aus synthetischen Fasern gekennzeichnet werden? Darf ich das so in Europa verkaufen?
Ja, solche Textilien dürfen in der EU verkauft werden, sofern die Fasern korrekt deklariert werden. Die Textilkennzeichnungsverordnung (EU) Nr. 1007/2011 schreibt vor, dass alle Bestandteile mit ihrem prozentualen Anteil und ihrer gesetzlich zugelassenen Faserbezeichnung angegeben werden müssen. Die Kennzeichnung könnte also zum Beispiel lauten: „80 % Wolle, 20 % Polyester“. Wichtig ist, dass die Bezeichnung der Kunstfaser aus der Liste der zulässigen Faserarten (ab Seite 12 der Verordnung) stammt.
20. Ich webe Handtücher, Decken und Schals auf einem eigenen Webstuhl – teils aus gekauften Garnen, teils aus selbstgesponnener Wolle oder Tierhaaren.
Auch beim Verkauf auf Märkten gilt die EU-Textilkennzeichnungsverordnung. Jedes Textilerzeugnis muss ein Etikett oder eine Kennzeichnung mit der genauen Faserzusammensetzung tragen – unabhängig davon, ob es industriell oder handwerklich hergestellt wurde. Das bedeutet: Auch handgewebte Produkte benötigen eine korrekte Angabe der verwendeten Fasern (z. B. „80 % Schurwolle, 20 % Alpaka“), die dauerhaft, gut lesbar und fest angebracht sein sollte.
21. Müssen die Begriffe „Grundmaterial“ und „Stickereifäden“ auf dem Textilkennzeichnungsetikett verwendet werden, oder gibt es zulässige Synonyme?
Zusammensetzungen müssen klar, eindeutig und für Verbraucher verständlich angegeben werden. Begriffe wie „Grundmaterial“ oder „Stickereifäden“ dienen dabei der sachlichen Beschreibung der Bestandteile. Sie sind nicht zwingend vorgeschrieben, solange aus der Kennzeichnung zweifelsfrei erkennbar ist, welche Teile sich auf welche Faserzusammensetzung beziehen.
Zulässig sind also auch gleichwertige, beschreibende Synonyme wie z. B. „Hauptstoff“ statt „Grundmaterial“ oder „Stickgarn“ statt „Stickereifäden“ – entscheidend ist, dass die Bezeichnung verständlich, eindeutig und nicht irreführend ist.
- Direkte Hilfe ohne lange Wartezeiten
- Vertretung durch erfahrene, spezialisierte Rechtsanwälte
- Wir unterstützen dich auch bei berechtigten Abmahnungen
22. Genügt im Online-Shop ein Bild, das Herstelleretikett und Materialangaben zeigt?
In der Theorie reicht ein Bild, in der Praxis ist ein Bild aber nicht barrierefrei. Personen, die beispielsweise eine Sehbeeinträchtigung haben, können sich die Inhalte des Bildes nicht über ein Programm vorlesen lassen.
23. Was ist, wenn ein Pulli kein Etikett hat und man nichts darüber weiß?
An jedes Produkt gehört eine Herstellerkennzeichnung, bei Textilien eben auch die Textilkennzeichnung. Ohne eine entsprechende Kennzeichnung darfst du das Produkt nicht verkaufen.
24. Genügt es, die ID-Nummer zur Rückverfolgung nur auf der Rechnung anzugeben?
Wichtig ist, dass du die Produktsicherheitsangaben wie die Identifizierung des Produktes in der Artikelbeschreibung im Shop bereits hältst. Eine Angabe auf der Rechnung ist nicht nötig.
25. Fallen Matratzen unter das Textilkennzeichnungsgesetz?
Ja, Matratzen können unter das Textilkennzeichnungsgesetz fallen – allerdings nur, wenn der Bezug überwiegend aus Textilfasern besteht und fest mit dem Matratzenkern verbunden ist oder typischerweise mitverkauft wird. Dann muss die Faserzusammensetzung des textilen Bezugs nach der EU-Textilkennzeichnungsverordnung (Verordnung (EU) Nr. 1007/2011) angegeben werden.
26. Muss ich mich als Kleingewerbe auch an das Textilkennzeichnungsgesetz halten?
Ja. Die Textilkennzeichnungsverordnung gilt unabhängig von der Unternehmensgröße – also auch für Kleingewerbe. Auch bei kleinen Stückzahlen ist die Kennzeichnungspflicht relevant.
27. Darf ich eine Hose mit 70 % Baumwolle und 30 % Leinen als „Leinenhose“ bewerben?
Lieber nicht. Auch wenn der Leinenanteil sichtbar ist, wäre die Bezeichnung „Leinenhose“ rechtlich problematisch und könnte als irreführende Werbung gelten. Nach der Textilkennzeichnungsverordnung darf eine Faser nur dann im Produktnamen hervorgehoben werden, wenn sie den Hauptanteil ausmacht oder den Charakter des Produkts prägt. In diesem Fall ist es besser, das Produkt als „Hose aus Leinenmischung“ oder „Baumwoll-Leinen-Mix“ zu bewerben.
28. Ich verkaufe selbst gestrickte Stirnbänder und Mützen und habe bisher nur lose Zettel mit Faserzusammensetzung und Pflegehinweisen beigelegt. Reicht das aus, oder müssen die Angaben fest angebracht sein?
Nach der Textilkennzeichnungsverordnung müssen Angaben zur Faserzusammensetzung dauerhaft, leicht lesbar und fest mit dem Produkt verbunden sein. Lose Zettel oder Anhänger reichen in der Regel nicht aus, da sie leicht entfernt werden können. Um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen, sollten die Etiketten daher eingenäht oder fest angebracht werden. Pflegehinweise sind freiwillig, sollten aber ebenfalls gut sichtbar und haltbar angebracht sein.
29. Ich bin ein Importeur mit Sitz im Vereinigten Königreich und verkaufe Kleidung an einen Online-Händler in Deutschland. Gelte ich als Hersteller und müssen meine Angaben auf dem Pflegeetikett stehen?
Wenn du als Importeur im Vereinigten Königreich Kleidung an einen Online-Händler in Deutschland verkaufst und der tatsächliche Hersteller in Fernost keine EU-Vertretung hat, wirst du nach der EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR) in der Regel als Hersteller angesehen.
Das bedeutet, dass du dafür verantwortlich bist, dass deine Kontaktdaten auf den Pflegeetiketten der Kleidungsstücke angegeben werden. Dazu gehören dein Name, deine eingetragene Handelsbezeichnung oder Marke sowie eine Kontaktanschrift innerhalb der EU.
30. Darf ich Abkürzungen wie „CO“ (Baumwolle) oder „PES“ (Polyester) statt der offiziellen Faserbezeichnungen verwenden?
Nein. Nach VO (EU) 1007/2011 sind nur die zulässigen Faserbezeichnungen in der jeweiligen Amtssprache erlaubt (z. B. „Baumwolle“, „Polyester“). Abkürzungen oder Fantasiebegriffe sind unzulässig. Du kannst interne Codes ergänzen, aber die offizielle Bezeichnung muss klar und vorrangig angegeben sein.
* Alle Preise netto zuzüglich gesetzliche Mehrwertsteuer. Die Mindestlaufzeit beträgt 12 Monate.
** Hilfe bei Abmahnungen ist eine freiwillige solidarische Unterstützungsleistung für Mitglieder des Händlerbund e.V. Die Bedingungen der Abmahnhilfe ergeben sich aus der Rechtsschutzordnung des Händlerbund e.V.