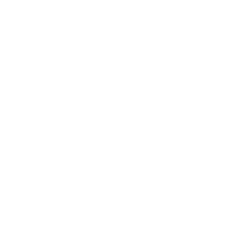Worum geht es beim EU Data Act?
Der EU Data Act (Verordnung (EU) 2023/2854) ist eine neue EU-Datenverordnung, die den Umgang mit Daten aus vernetzten Geräten und Diensten neu regelt. Ziel ist es, einen fairen Zugang zu und die Nutzung von Daten sicherzustellen – sowohl für Nutzer als auch für Drittanbieter und Behörden.
Konkret stärkt der Data Act die Rechte der Nutzer von IoT-Geräten (Internet of Things) und schafft klare Pflichten für Hersteller und Händler solcher Produkte. Online-Händler, die smarte oder vernetzte Produkte verkaufen, sollten sich frühzeitig mit den neuen Regeln vertraut machen, denn ab 2025 gelten umfangreiche neue Pflichten in der EU.
Stichtage und Übergangsfristen
- Inkrafttreten: Die Data-Act-Verordnung ist am 11. Januar 2024 in Kraft getreten. Ab diesem Datum ist sie gültiges EU-Recht.
- Anwendbarkeit: Großteils anwendbar seit dem 12. September 2025. Ab diesem Tag gelten die neuen Regeln unmittelbar in allen EU-Mitgliedstaaten – ohne Umsetzung in nationales Recht, da es eine Verordnung ist. Online-Händler müssen bis dahin ihre Prozesse und Produktinformationen anpassen.
- Spätere Fristen: Einzelne spezielle Vorschriften greifen erst seit dem 12. September 2026. Dazu gehört insbesondere das Prinzip Access by Design (siehe unten), für das Herstellern ein Jahr länger Übergangszeit gewährt wird.
Wer ist vom Data Act betroffen?
Der Data Act betrifft vor allem: Hersteller und Anbieter von vernetzten Produkten sowie Anbieter digitaler Dienste, die mit solchen Produkten verbunden sind. Auch Händler, die solche Produkte vertreiben (z. B. im Online-Shop), sind in der Verantwortung, bestimmte Informationspflichten zu erfüllen.
Was sind vernetzte Produkte? Darunter versteht man physische Produkte, die während ihrer Nutzung automatisiert Daten erfassen, erzeugen oder übertragen – oft via WLAN, Bluetooth, über eine App oder die Cloud. Umgangssprachlich spricht man von smarten oder IoT-Geräten. Typische Beispiele vernetzter Produkte sind:
- Smartwatches und Fitness-Tracker: Erfassen z. B. Gesundheits- und Aktivitätsdaten (Schritte, Herzfrequenz, Schlafmuster etc.).
- Smart-TVs: Übermitteln Nutzungsdaten wie etwa die Streaming-Historie oder Einstellungen.
- Smarte Haushaltsgeräte: Zum Beispiel internetfähige Kühlschränke, Thermostate, Waschmaschinen oder Staubsauger-Roboter, die Betriebsdaten aufzeichnen.
- Sprachassistenten: Geräte wie Amazon Alexa oder Google Home, die stimmaktivierte Dienste bieten und Daten über Anfragen sammeln.
- Smart Home Komponenten: Etwa vernetzte Heizungen, Alarmanlagen oder steuerbare Beleuchtung und Fensterläden.
- Connected Cars oder E-Scooter: Fahrzeuge mit Internetanbindung, die Telemetriedaten (Standort, Geschwindigkeit, Batteriestatus, Fahrverhalten etc.) generieren und senden.
Verbundene digitale Dienste: Ebenfalls erfasst sind digitale Dienste, ohne die ein vernetztes Produkt nicht funktionieren kann. Dazu gehören z. B. die Betriebssoftware eines smarten Geräts (etwa das OS eines Smartphones oder einer Smartwatch) oder zugehörige Apps und Cloud-Plattformen, über die das Gerät gesteuert wird. Kurz: Auch die Software- und Service-Komponente von IoT-Produkten fällt unter den Anwendungsbereich des Data Act.
Neue Pflichten: Was ändert sich durch den Data Act?
Der Data Act bringt zwei zentrale Neuerungen mit sich, die für Online-Händler und Hersteller relevant sind:
-
„Access by Design“ – Recht auf Datenzugang: Nutzer von vernetzten Produkten erhalten das Recht, die bei der Nutzung entstehenden Produktdaten direkt und einfach einzusehen und zu exportieren. Hersteller müssen ihre Geräte und Dienste also so gestalten, dass dieser Datenzugang ab Werk möglich ist.
-
Erweiterte vorvertragliche Informationspflichten: Bereits vor dem Kauf eines vernetzten Produkts oder Dienstes müssen Kunden umfassend darüber informiert werden, welche Daten das Gerät erzeugt und wie damit umgegangen wird. Diese Transparenzpflichten betreffen sowohl Hersteller als auch Händler, die die Informationen an Endkunden weitergeben müssen.
Im Folgenden beleuchten wir diese Punkte im Detail und geben Hinweise zur Umsetzung im Handel.
Access by Design: Direkter Datenzugang für Nutzer
Was bedeutet „Access by Design“? Hersteller sind verpflichtet, vernetzte Produkte und zugehörige Dienste so zu konzipieren, dass Nutzer einen unmittelbaren Zugang zu den bei der Nutzung anfallenden Daten haben. Der Datenzugriff soll integraler Bestandteil des Produktdesigns sein („Datenzugang ab Werk“). Nutzer dürfen nicht länger nur darauf angewiesen sein, dass der Hersteller vielleicht freiwillig eine Einsicht gewährt – sie haben künftig einen gesetzlich einklagbaren Anspruch darauf.
Konkret heißt das: Wenn ein Gerät genutzt wird und dabei Daten aufzeichnet, muss der Endnutzer diese Informationen leicht auffindbar, verständlich und möglichst in Echtzeit abrufen können. Zudem müssen die Daten in strukturierter, maschinenlesbarer Form bereitstehen, damit der Nutzer sie z. B. als Datei (CSV, JSON o.Ä.) exportieren und weiterverwenden kann.
Beispiele aus der Praxis: Viele gängige smarte Geräte bieten schon heute Einsicht in Nutzungsdaten – oft als Kernfunktion. Der Data Act schreibt dies nun verbindlich vor. So könnte Access by Design in der Praxis aussehen:
- Smartwatch/Fitness-Tracker: Der Nutzer kann seine Gesundheits- und Fitnessdaten jederzeit in der begleitenden App einsehen (Schrittzahl, Herzfrequenz, Schlafdauer etc.) und diese Daten bei Bedarf als Datei exportieren.
- Smart TV: Im Einstellungsmenü des Fernsehers findet der Nutzer eine Übersicht über die erfassten Nutzungsdaten (z. B. welche Apps wie lange genutzt wurden oder persönliche Empfehlungen) und kann diese bei Bedarf löschen oder herunterladen.
- Smarte Heizungssteuerung: In der Heizungs-App sieht der Nutzer aktuelle und historische Daten zu Temperaturen, Heizzeiten und Energieverbrauch in Echtzeit. Er kann diese Verlaufsdaten als CSV-Datei exportieren, um sie z. B. zu analysieren.
- Vernetzte Haushaltsgeräte (Waschmaschine, Staubsauger-Roboter): Die App zeigt dem Nutzer Statistiken, etwa wie häufig welche Programme genutzt wurden oder wann der letzte Reinigungslauf war. Diese Nutzungsdaten können heruntergeladen oder mit anderen geteilt werden.
- Vernetztes Fahrzeug (E-Auto, vernetzter E-Scooter): Eine Web-Plattform oder App liefert dem Besitzer Informationen wie gefahrene Strecken, Batteriestand, Ladezyklen oder Wartungsdaten – mit der Möglichkeit, diese Daten als Datei zu exportieren und beispielsweise an eine Werkstatt weiterzugeben.
Ist das nicht längst Standard? Tatsächlich bieten viele Smart-Geräte bereits umfangreiche Dateneinsichten. Eine Smartwatch ohne Anzeige der Fitnessdaten wäre kaum verkäuflich. Neu ist jedoch, dass Nutzer nun einen rechtlichen Anspruch auf diesen Zugang erhalten.
Bisher geschah die Datenbereitstellung meist freiwillig als Feature; ab 2025/2026 muss der Zugriff gewährt werden, und zwar nach klaren Kriterien: leicht zugänglich (kein verstecktes Menü), transparent strukturiert und technisch so umgesetzt, dass Daten weiterverwendbar sind. Hersteller, die das noch nicht umgesetzt haben, müssen nachrüsten. Das betrifft v.a. kleinere oder spezialisierte Anbieter, die bisher vielleicht weniger Wert auf Datenexport gelegt haben.
Als Online-Händler solltest du künftig nur noch Produkte anbieten, bei denen die Datenzugänglichkeit gewährleistet ist. Achte in den Produktdatenblättern und Herstellerinformationen auf Hinweise, dass das Gerät einen Nutzerdaten-Zugang bietet. Im Zweifel frage beim Hersteller nach, wie der Access by Design-Grundsatz umgesetzt wurde. Außerdem empfiehlt es sich, diese Eigenschaft in der Produktbeschreibung zu erwähnen – zum einen als Verkaufsargument, zum anderen um zu zeigen, dass Ihr Shop die gesetzlichen Anforderungen erfüllt.
Zeitlicher Hinweis: Die Pflicht zum Access by Design greift gemäß Data Act erst ab 12. September 2026. Dennoch sollten Händler schon vorher darauf achten, da viele Geräte, die ab 2025 verkauft werden, dieses Merkmal erfüllen müssen, um rechtskonform zu sein.
Neue vorvertragliche Informationspflichten für Händler
Eine der größten Herausforderungen des Data Act für den Handel sind die erweiterten Informationspflichten vor Vertragsschluss.
Kunden müssen vor dem Kauf eines vernetzten Produkts oder eines dazugehörigen Dienstes klar und verständlich darüber informiert werden, welche Daten anfallen und was damit geschieht. Diese Pflicht trifft Hersteller und Händler gleichermaßen. Der Hersteller muss die nötigen Infos bereitstellen, und der Händler muss sie an die Endkunden weitergeben, z.B. auf der Produktseite im Online-Shop.
Welche Informationen müssen vor dem Kauf gegeben werden? Die Verordnung schreibt detailliert vor, was der Kunde erfahren soll, bevor er sich für den Kauf entscheidet. Die Anforderungen unterscheiden sich leicht, je nachdem ob es um ein vernetztes Produkt oder einen verbundenen Dienst geht (oft werden beide zusammen verkauft, z. B. ein Gerät mit zugehöriger App). Im Wesentlichen sind folgende Punkte zu nennen:
Für vernetzte Produkte (IoT-Geräte):
- Art, Umfang und Format der erzeugten Daten: Beschreibe, welche Art von Daten das Produkt generiert (z. B. Sensor-Daten wie Temperatur, Nutzungsdaten wie Verbrauch, persönliche Daten wie Gesundheitswerte) und in welchem Format bzw. ungefähren Umfang diese anfallen. Der Kunde soll eine Vorstellung bekommen, welche Datensätze entstehen (z. B. “Speichert pro Stunde Betriebsdauer und Temperaturdaten als Logfile, ca. 1 MB pro Tag”).
- Kontinuierliche Datengenerierung: Stelle klar, ob das Produkt Daten kontinuierlich in Echtzeit erzeugt und ggf. übermittelt. Einige Geräte senden dauerhaft Daten (z. B. ein Fitness-Tracker synchronisiert Schritte laufend), andere nur bei bestimmten Aktionen. Kunden müssen wissen, ob eine permanente Datenerfassung stattfindet.
- Speicherung der Daten: Gib an, wo die Daten gespeichert werden – auf dem Gerät selbst, in einer Cloud/Infrastruktur des Herstellers oder auf einem Server eines Drittanbieters. Falls Cloud-Speicherung erfolgt, nenne nach Möglichkeit die Region oder den Betreiber. Auch die Speicherdauer ist relevant: Wie lange bleiben die Daten erhalten? (Z. B. “Daten werden 12 Monate in der App-Cloud gespeichert und danach automatisch gelöscht.”)
- Zugriff, Abruf und Löschung: Erkläre, wie der Nutzer auf seine Daten zugreifen, sie auslesen oder löschen kann. Nenne die technischen Mittel oder Schnittstellen: z. B. “Über die begleitende Smartphone-App können Sie Ihre Daten in Echtzeit einsehen. In der App gibt es zudem eine Export-Funktion (CSV/JSON) sowie die Möglichkeit, alle Verlaufsdaten zu löschen.” Weise auch auf Nutzungsbedingungen oder Service-Qualität hin, falls relevant (etwa wenn der Datenabruf nur mit Internetverbindung und Registrierung möglich ist, oder wenn es Beschränkungen in der Verfügbarkeit gibt).
Für verbundene Dienste (digitale Services zu einem Produkt):
- Art, Umfang, Häufigkeit der Datenerhebung: Hier ähnlich wie beim Produkt – beschreibe, welche Daten der Dienst (z. B. eine Cloud-Software oder App) vom Produkt oder Nutzer sammelt, wie viel davon anfällt und wie oft. Beispiel: “Die App erfasst bei jeder Synchronisation Ihre aktuellen Fitnessdaten (Schritte, Puls) und speichert sie in der Cloud. Pro Tag werden ca. 24 Datensätze übertragen (stündliche Synchronisation).”
- Zugriffsmöglichkeiten des Nutzers: Erkläre, wie der Nutzer auf diese Dienst-Daten zugreifen oder sie abrufen kann. Oft überschneidet sich das mit dem Gerätezugriff – wichtig ist, dass der Nutzer auch die in einem Online-Konto oder Cloud gespeicherten Daten einsehen und exportieren kann.
- Identität und Kontaktdaten des Dateninhabers: Gib an, wer der “Dateninhaber” ist – also welches Unternehmen die Kontrolle über die gespeicherten Daten hat. Das ist in der Regel der Anbieter des Dienstes (z. B. der Hersteller oder eine Cloud-Firma). Nenne dessen Name und Kontaktmöglichkeit. Beispiel: “Dateninhaber: XYZ GmbH, Musterstraße…, E-Mail: datenschutz@xyz.de”.
- Datenweitergabe an Dritte: Informiere, wie der Nutzer veranlassen kann, dass die Daten an einen Dritten weitergegeben werden, und wie er eine solche Weitergabe ggf. beenden kann. Der Data Act gewährt Nutzern das Recht, die vom Gerät erzeugten Daten auch an Dienste Dritter schicken zu lassen (z. B. zu einem anderen Anbieter wechseln oder Daten an eine Reparaturwerkstatt geben). Beschreibe kurz das Prozedere: “Sie können jederzeit verlangen, dass XYZ Ihre Gerätedaten an einen von Ihnen benannten Drittanbieter übermittelt. Kontaktieren Sie hierfür unseren Support. Sie können diese Datenweitergabe auch jederzeit widerrufen.”
- Beschwerderecht: Weise darauf hin, dass der Nutzer ein Recht hat, sich zu beschweren, wenn etwas mit dem Datenzugang oder -gebrauch nicht stimmt. In vielen Fällen dürfte dies bedeuten, dass der Nutzer sich an die Aufsichtsbehörden oder den betrieblichen Datenschutzbeauftragten wenden kann. Ein einfacher Hinweis wie “Ihnen steht ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu” kann hier genügen, ggf. mit Verweis auf weitere Infos in der Datenschutzerklärung.
- Geschäftsgeheimnisse: Falls an den erzeugten Daten Geschäftsgeheimnisse hängen, muss das offengelegt werden. Konkret verlangt der Data Act die Info, ob der Dateninhaber selbst Inhaber von Geschäftsgeheimnissen ist, die in den Daten enthalten sind. Falls nicht, ist anzugeben, wer der Inhaber der Geschäftsgeheimnisse ist. (Dieses Detail ist eher in B2B-Konstellationen relevant; im Consumer-Bereich seltener. Im Zweifel kann der Hersteller dazu Auskunft geben.)
- Vertragsdauer und Kündigung: Falls es für den verbundenen Dienst einen separaten Vertrag mit dem Nutzer gibt (z. B. ein Cloud-Service-Vertrag oder AGB für eine App), nenne die Laufzeit des Vertrags bzw. ob er unbefristet ist, sowie die Modalitäten der Kündigung. Beispiel: “Die Nutzung der App ist unbefristet möglich und kostenlos. Du könntest den Nutzungsvertrag jederzeit durch Löschung Ihres Accounts beenden.” Bei kostenpflichtigen Services ggf. die Vertragslaufzeit und Verlängerungsklauseln benennen.
Wie man sieht, sind die Anforderungen ziemlich detailliert. Für Händler bedeutet das einen erheblichen Informationsbedarf, den sie oft nur in Zusammenarbeit mit dem Hersteller decken können. Praktisch wird ein Online-Händler sich vom Hersteller oder Großhändler die erforderlichen Daten geben lassen müssen – am besten in Form eines Datenblatts oder Katalogtexts, der all die oben genannten Punkte abdeckt.
Wie schwierig ist das umzusetzen?
Grundsätzlich ist es machbar, erfordert aber Aufwand: Händler müssen ihre Produktbeschreibungen ergänzen und ggf. das Layout ihrer Shops anpassen, um diese Infos sichtbar zu machen. Du bist dabei auf Zulieferung vom Hersteller angewiesen. Insbesondere kleinere Hersteller müssen eventuell erst die nötigen Informationen zusammenstellen. Als Händler solltest du frühzeitig auf deine Lieferanten zugehen und die Data-Act-Infos anfordern, damit du sie rechtzeitig in dein Angebot einpflegen kannst.
Praktische Umsetzung der Informationspflicht im Online-Shop
Die vorvertraglichen Daten-Infos müssen klar, gut sichtbar und verständlich vor dem Kaufabschluss zur Verfügung gestellt werden. Das wirft die Frage auf: Wo und wie platziert man diese Informationen am besten? Hier einige Optionen aus der Praxis und ihre Eignung:
In der Produktbeschreibung auf der Produktseite
- Sehr gut geeignet
- Am effizientesten ist es, direkt auf der Artikel-Detailseite einen Abschnitt einzufügen, z. B. mit der Überschrift „Hinweise zur Datennutzung des Produkts“. Darunter können stichpunktartig oder in kurzen Sätzen die erforderlichen Angaben gemacht werden (wie oben beschrieben). So sieht der Kunde alle Infos genau dort, wo er sich über das Produkt informiert. Vorteil: Höchste Transparenz und Erfüllung der Pflicht, da der Kunde vor dem Kauf deutlich informiert wird.
Separate Infoseite mit Link
- Gut geeignet
- Du kannst in der Produktbeschreibung einen Link setzen wie „Weitere Informationen zur Datennutzung dieses Produkts finden Sie hier.“ Der Link führt zu einer ausführlichen Infoseite oder FAQ zu dem Produkt. Diese Methode ist zulässig, sofern der Link klar bezeichnet und leicht zugänglich ist. Empfehlenswert ist sie als Ergänzung: Kerninfos kurz auf der Produktseite + Link auf Detailseite, falls der Kunde mehr wissen will.
Pop-up oder Hinweis erst im Checkout
- Möglich, aber riskant
- Ein Hinweisfenster oder Tooltip, das erst beim Hinzufügen zum Warenkorb oder während des Bezahlvorgangs erscheint, ist rechtlich kritisch. Zu diesem späten Zeitpunkt hat sich der Kunde oft schon für den Kauf entschieden. Die Info muss aber vor Vertragsabschluss unübersehbar sein. Ein Pop-up im Checkout sollte, wenn überhaupt, nur ergänzend genutzt werden, nicht als primäre Lösung.
Im Produktdatenblatt (PDF oder Tabelle) zum Download
- Allein nicht ausreichend (nur ergänzend)
- Ein technisches Datenblatt vom Hersteller, das die Dateninformationspflichten abdeckt, kann hilfreich sein – vor allem bei sehr komplexen Geräten. Allerdings reicht das allein nicht aus, denn der Kunde müsste aktiv das PDF öffnen. Wichtig ist, dass zumindest die Kerndaten bereits auf der Produktseite sichtbar sind.
Beilage im Paket
- Unzureichend
- Jegliche Information, die erst nach Vertragsschluss bereitgestellt wird (z. B. ein Hinweisblatt im Produktkarton oder eine E-Mail nach Kauf), erfüllt die vorvertragliche Pflicht nicht. Solche Maßnahmen können zwar zusätzlich zur Kundenaufklärung beitragen, ersetzen aber keinesfalls die Pflichtangaben vor dem Kauf.
Die Pflichtinfos müssen klar, sichtbar und verständlich vor dem Kauf gegeben werden. Am praktikabelsten ist ein eigener Abschnitt in der Online-Produktbeschreibung, ggf. ergänzt durch ein detailliertes Hersteller-Datenblatt oder eine verlinkte Infoseite. Online-Händler sind gut beraten, diese Änderungen frühzeitig anzugehen, um rechtzeitig zum Stichtag konform zu sein.
Wie unterstützt dich der Händlerbund im Data Act
Die Umsetzung des Data Act mag zunächst komplex erscheinen – aber du musst das Rad nicht neu erfinden. Wir beim Händlerbund unterstützen unsere Mitglieder dabei, die neuen Anforderungen zu verstehen und praktisch umzusetzen:
Was wir für dich tun
Unsere Rechtsexperten bieten persönliche Beratungen an – auch schon im Basic-Mitgliedschaftspaket via Chat. Wir helfen dir einzuschätzen, ob und wie dein Online-Shop vom Data Act betroffen ist, und welche Schritte in deinem individuellen Fall notwendig sind.
Keine Anpassung der Rechtstexte nötig
Eine gute Nachricht vorweg – deine bestehenden Rechtstexte (AGB, Datenschutzerklärung etc.) müssen aufgrund des Data Act nicht geändert werden. Die neuen Pflichten betreffen hauptsächlich die Produktinformationen und technischen Abläufe. Wir prüfen natürlich laufend, ob sich daraus indirekt Änderungsbedarf in Rechtsdokumenten ergibt, aber aktuell sehen wir keinen Anpassungszwang für etwa AGB.
* Alle Preise netto zuzüglich gesetzliche Mehrwertsteuer. Die Mindestlaufzeit beträgt 12 Monate.
** Hilfe bei Abmahnungen ist eine freiwillige solidarische Unterstützungsleistung für Mitglieder des Händlerbund e.V. Die Bedingungen der Abmahnhilfe ergeben sich aus der Rechtsschutzordnung des Händlerbund e.V.
Fazit Data Act
Der Data Act bringt ab 12. September 2025 weitreichende Änderungen für alle, die vernetzte Produkte anbieten. Online-Händler sollten das Thema jetzt angehen, um ihre Shop-Inhalte und Prozesse rechtzeitig anzupassen.
Die gute Nachricht ist: Viele Anforderungen (z. B. Datenzugriff für Nutzer) sind in modernen Smart-Produkten bereits angelegt. Jetzt gilt es, diese Stärken deutlich herauszustellen und die nötigen Infos transparent zu machen. Mit sorgfältiger Vorbereitung und ggf. externer Unterstützung (etwa durch den Händlerbund) lassen sich die neuen Pflichten gut bewältigen.
So stellst du sicher, dass dein Geschäft auch in der Daten-Zukunft rechtssicher und kundenfreundlich bleibt.
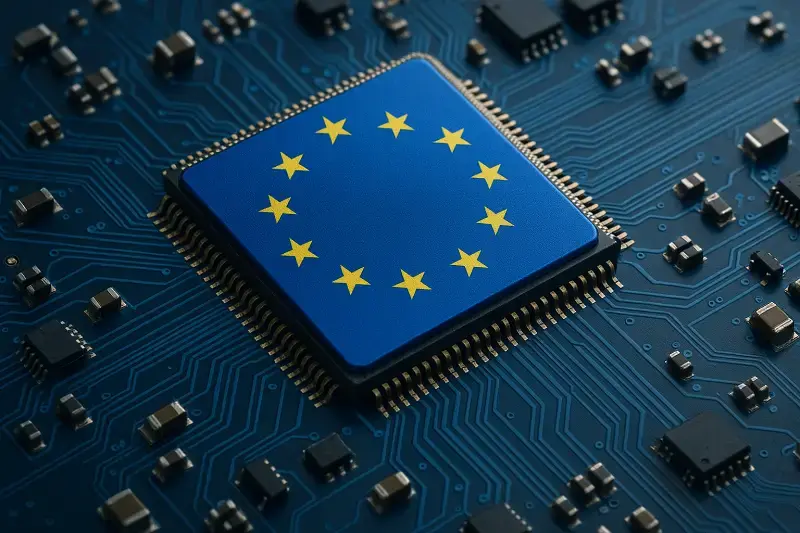

Geschrieben von
Mario Csonka
Das könnte dich auch interessieren:
- Regelungen zum Handel mit Elektro- & Elektronikartikeln
- Abmahnung nach dem Elektrogesetz
- Für Händler: Was du zum Elektrogesetz wissen musst
- Für Hersteller: Alles, was du zum Elektrogesetz wissen musst
- Alles Wichtige zur CE-Kennzeichnung
- Verkauf von Elektro- und Elektronikprodukten (E-Book)
- Checkliste: Verkauf von Elektro- und Elektronikprodukten (Hinweisblatt)