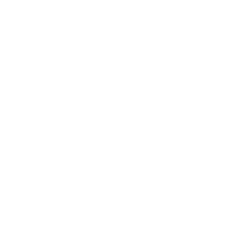Was hat die Registrierungspflicht mit Online-Händlern zu tun?
Grundsätzlich dürfen registrierungspflichtige Geräte nur dann verkauft werden, wenn sie ordnungsgemäß bei der Stiftung EAR registriert sind. Bei der Registrierungspflicht handelt es sich zwar um eine Obliegenheit, die der Hersteller erfüllen muss. Der Händler muss aber dennoch darauf achten, dass diese Pflicht erfüllt wurde.
Info:
Verkauft ein Händler Geräte, die nicht registriert sind, so gilt er als Hersteller. Er kann also für die fehlende Registrierung belangt werden.
Woher wissen Händler, dass ein Gerät registriert wurde?
Hersteller sind dazu verpflichtet, ihre WEEE-Nummer im geschäftlichen Verkehr zu führen. Daher finden Händler die Nummer immer auf der Rechnung. Wer auf Nummer sicher gehen will, kann die WEEE-Nummer dann in dem Register der Stiftung EAR eingeben und schauen, ob der Hersteller auch wirklich Geräte registriert hat.
Bin ich rücknahmepflichtig?
Als Händler gibt es zwei Arten von Rücknahmepflichten, an die gedacht werden muss:
1:1-Rücknahmepflicht
Online-Händler, die mehr als 400 Quadratmeter Lager- und Versandfläche für Elektro- und Elektronikgeräte verfügen, sind dazu verpflichtet, bei der 1:1-Rücknahme von Altgeräten der Kategorien 1 (Wärmeüberträger wie Kühlschränke, aber auch Luftbefeuchter und Camping Kühlboxen), 2 (Bildschirme mit einer Oberfläche von mehr als 100 cm²) und 4 (Geräte, bei der mindestens eine äußere Abmessung mehr als 50 cm beträgt) eine kostenfreie Abholung beim Kunden anzubieten.
Seit dem 1. Januar 2022 sind Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern verpflichtet, beim Verkauf eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen. Die Regelung gilt für Läden, die mehrmals im Kalenderjahr Elektro- und Elektronikgeräte zum Kauf anbieten oder bereitstellen und über eine Gesamtverkaufsfläche von 800 Quadratmetern verfügen.
Es muss es sich bei dem zurückgegebenen Altgerät nicht um ein in allen Merkmalen identisches Gerät handeln, da ansonsten der technologischen Entwicklung nicht Rechnung getragen werden könnte. So kann z. B. beim Neukauf eines LCD-Flachbildschirms auch ein herkömmliches CRT-Bildschirmgerät oder bei Neukauf eines Laptops ein Tower-PC zurückgegeben werden. Die Rücknahmeverpflichtung besteht dabei unabhängig davon, ob der Vertreiber die Marke des zurückgegebenen Geräts in seinem Sortiment führt.
Als Verkaufsfläche gelten alle Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte.
0:1-Rücknahmepflicht
Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern sind außerdem verpflichtet, Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, unentgeltlich zurückzunehmen. Die Besonderheit ist hier, dass die Rücknahme nicht an den Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes geknüpft werden darf. Ab dem 1. Januar 2022 wird die Beschränkung der Abgabe von fünf auf drei Altgeräte pro Geräteart herabgesetzt.
Alle übrigen Vertreiber, d.h. Vertreiber mit einer Verkaufsfläche von weniger als 400 Quadratmetern, können Altgeräte freiwillig zurücknehmen.
Guter Rat ist teuer? Nicht bei uns. Unsere auf E-Commerce-Recht spezialisierten Anwälte stehen dir bei rechtlichen Fragen gern zur Seite.
Rufe einfach an oder schreibe eine E-Mail.
Muss ich über die Rücknahmepflicht aufklären?
Rücknahmepflichtige Vertreiber müssen die privaten Haushalte über Folgendes informieren:
- die Rücknahmestellen, die sie selbst geschaffen haben
- die Eigenverantwortung der Endnutzer im Hinblick auf das Löschen personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten
- die Bedeutung des Symbols durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern
- über den Umstand, dass Besitzer von Altgeräten diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen haben. Sie sind zu informieren, dass Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen sind.
Darüber hinaus kommen auf Händler seit dem 1. Januar 2022 weitere Informationspflichten zu. Händler trifft in Zukunft die Pflicht, bei Abschluss eines Kaufvertrages darüber zu informieren, dass ein Altgerät beim Kauf eines neuen Gerätes kostenlos zurückgegeben werden kann. Davon umfasst sind Bildschirme und Monitore mit einer Oberfläche von mehr als 100 Quadratzentimetern, Wärmeüberträger und Großgeräte. Auch muss der Verbraucher über eine kostenfreie Abholung der Geräte in Kenntnis gesetzt werden und schon bei Anschluss des Kaufvertrages danach gefragt werden, ob er bei Lieferung des neuen Gerätes ein Altgerät zurückgeben möchte.
Im Online-Shop ist eine separate Schaltfläche mit der Bezeichnung "Hinweise zur Elektroaltgeräteentsorgung" oder ähnlicher Formulierung einzurichten und dort der entsprechende Hinweistext zentral einzustellen. Sofern es technisch nicht möglich ist, eine zentral abrufbare Schaltfläche mit den Hinweisen einzurichten (wie z.B. bei eBay oder ähnlichen Plattformen), soll der Hinweistext in die Artikelbeschreibungen mit eingefügt werden.
Bei der Pflicht zur Nachfrage, ob ein Altgerät wieder mitgenommen werden soll, ist eine gewisse Mitwirkung des Kunden notwendig. Daher muss eine konkrete Nachfrage des Händlers erfolgen, umzusetzen beispielsweise durch eine Checkbox.
Wie können Online-Händler die Rücknahmepflicht praktisch umsetzen?
Bei Fernabsatzgeschäften müssen einige Altgeräte künftig kostenfrei zurückgenommen werden. Die dafür bisher vom Verbraucher zu tragenden Versandkosten sollen dann vom Händler übernommen werden müssen. Von der Pflicht zur unentgeltlichen Abholung sind Geräte der Kategorie 1, 2 und 4 umfasst. Bei diesen Kategorien müssen Online-Händler künftig den Kunden ermöglichen, das entsprechende Altgerät kostenfrei dem Transportdienstleister, der das neue Gerät liefert, mitzugeben. Zu diesen Gerätekategorien zählen etwa Bildschirme und Monitore, Kühl- und Gefrierschränke und Großgeräte mit einer Abmessung von mehr als 50 Zentimeter.
Der pauschale Verweis auf Sammel- und Übergabestellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger (z. B. Wertstoffhöfe) sind keine geeigneten Rücknahmestellen. Grund: Könnten Online-Händler weiterhin nur auf die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger verweisen, würde dies eine eigene Rücknahmepflicht der Händler unterlaufen.
Für Geräte der Kategorien 3, 5 und 6 gilt die Regelung nicht. Online-Händler müssen allerdings geeignete Rückgabestellen in zumutbarer Entfernung des Kunden ermöglichen und Kooperationen mit dem stationären Handel oder Entsorgern schaffen. Denkbar sind z. B. Kooperationen mit dem stationären Handel oder Sozialbetrieben (z. B. Caritas, Lebenshilfe Werkstätten), zu denen der Endnutzer die Altgeräte direkt bringt. Die Rücknahmepflicht für Online-Händler gilt allerdings weiterhin erst ab einer Lagerfläche von 400 Quadratmetern allein für Elektrogeräte.
Vertreiber, die zur Rücknahme verpflichtet sind, müssen die eingerichteten Rücknahmestellen der zuständigen Behörde anzeigen. Die zuständige Behörde ist das Umweltbundesamt. Ordnungswidrig handelt nunmehr, wer ein Altgerät nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig zurücknimmt. Dieser Verstoß wird mit bis zu 100.000 Euro Bußgeld geahndet.
Checkliste zum ElektroG
Stelle deinen Shop auf die Probe
Beantworte die folgenden Fragen und finde heraus, ob du in Sachen Elektrogesetz rechtlich auf der sicheren Seite bist! Nach Ausfüllen der Checkliste erhältst du von uns eine kostenfreie Auswertung mit Handlungsempfehlungen.
Starte jetzt!
Weiterführende Leitfäden zu speziellen Elektro- und Elektronikartikeln
Als Händler gut beraten
Der Händlerbund steht dir gerne zu Seite und unterstützt dich bei rechtlichen Fragen. Wir machen uns stark für deine Rechtssicherheit: mit den passenden Rechtstexten und einer direkten Information, sollten sich Gesetze ändern. Darüber hinaus kannst du von unserem Informationsangebot, unseren Leitfäden und Mustervorlagen profitieren. Und wenn das Business wächst und der eigene Webshop ansteht, dann sind wir von Anfang an dein Partner für rechtssicheres Handeln im E-Commerce.
 FAQ: Die häufigsten Fragen rund ums Thema Elektrogesetz
FAQ: Die häufigsten Fragen rund ums Thema Elektrogesetz
Wofür ist das Elektrogesetz gut?
Mit dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz setzt Deutschland die WEEE-Richtlinie der Europäischen Union in nationales Recht um. Hauptziel ist hier der Umweltschutz: Altgeräte sollen nicht mehr über den Haushaltsmüll entsorgt, sondern getrennt gesammelt und recycelt werden. Es geht hierbei auch um die Wiederverwendung wertvoller Rohstoffe.
Außerdem geht es um nicht weniger, als die Verantwortung für den Elektroschrott: Hergestellte Elektro- und Elektronikgeräte haben nur eine begrenzte Lebenszeit und landen früher oder später im Müll. Für diese Entsorgung sollen aber nicht die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger aufkommen, sondern die Hersteller. Diese tragen für die durch sie in Verkehr gebrachten Waren die Verantwortung. Verstöße können eine Abmahnung nach dem Elektrogesetz nach sich ziehen; diese werden meist durch Wettbewerber ausgesprochen.
Welche Rolle spielt dabei die Stiftung EAR?
EAR steht für Elektro-Altgeräte-Register. Der Stiftung wurden im Zuge der Umsetzung der WEEE-Richtlinie die hoheitlichen Aufgaben und Befugnisse aus dem Elektrogesetz übertragen:
- Registrierung von Herstellern, die in Deutschland Elektrogeräte in Verkehr bringen, bzw. im Falle der Bevollmächtigung nach § 8 ElektroG von deren Bevollmächtigten
- Garantieprüfung
- Feststellung von kollektiven Herstellergarantiesystemen
- Erfassung der in Verkehr gebrachten Mengen von Elektrogeräten
- Koordinierung der Bereitstellung von Behältnissen für Übergabestellen und der Altgeräte-Abholung bei den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern
- Gebührenerhebung für die von ihr erbrachten öffentlichen Leistungen
Wie funktioniert das Entsorgungssystem?
Geht ein Gerät kaputt, so darf es vom Besitzer nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Die Gemeinden haben dafür Sammelstellen eingerichtet. Hier werden die Altgeräte in sechs verschiedenen Gruppen in Behältern gesammelt. Ist ein Behälter voll, wird das der Stiftung EAR gemeldet. Diese ermittelt dann, welcher Hersteller oder Bevollmächtigte für die Abholung des Behältnisses und die Aufstellung eines neuen verantwortlich ist. Da die wenigsten diese Aufgabe aus eigener Hand erfüllen können, wird die Abholung der Altgeräte, die Aufstellung eines neuen Behältnisses und die weitergehende Behandlung/Verwertung/Entsorgung oftmals an einen Entsorger oder Erstbehandler übertragen.
Muss ich mich bei der Stiftung EAR registrieren?
Registrieren muss sich jeder, der registrierungspflichtige Geräte herstellt und in Verkehr bringt. Allerdings gelten auch jene als registrierungspflichtig, die vorsätzlich oder fahrlässig Geräte anbieten, die nicht oder nicht ordnungsgemäß bei EAR registriert sind.
Wann gelte ich als Hersteller?
Unter dem Begriff des Herstellers versteht das Gesetz nicht nur den Hersteller im klassischen Sinne. Als Hersteller werden ganz konkret verpflichtet:
- Händler, die Elektro- und Elektronikgeräte unter ihrem Namen oder ihrer Marke herstellen lassen und innerhalb Deutschlands anbieten oder konzipieren. Aber auch: Händler, die Geräte herstellen lassen und sie unter ihrem Namen oder ihrer Marke in Deutschland anbieten.
- Händler, die Geräte anderer Hersteller unter dem eigenen Namen oder der eigenen Marke in Deutschland weiter verkauft. Achtung: Dies gilt nicht, wenn auf dem Gerät der Name oder die Marke des Herstellers erscheint.
- Händler, die Geräte, die nicht aus Deutschland stammen, erstmals auf dem deutschen Markt anbieten.
- Händler, die nicht in Deutschland niedergelassen sind, aber direkt über Fernkommunikationsmittel an Endnutzer verkaufen.
- Vorsicht: Als Hersteller („Quasi-Hersteller“) gilt auch derjenige, der vorsätzlich oder fahrlässig Geräte anbietet, die nicht oder nicht ordnungsgemäß registriert sind. Das bedeutet nichts anderes, als dass Händler in solchen Fällen haften, als wären sie Hersteller.
Welche Geräte sind betroffen?
Vom Elektrogesetz sind sämtliche Elektro- und Elektronikgeräte betroffen. Unter Elektro- und Elektronikgeräten versteht das Gesetz „Geräte, die für den Betrieb mit Wechselspannung von höchstens 1000 Volt oder Gleichspannung von höchstens 1500 Volt ausgelegt sind und zu ihrem ordnungsgemäßen Betrieb von elektrischen Strömen oder elektromagnetischen Feldern abhängig sind oder bei der Erzeugung, Übertragung und Messung von elektrischen Strömen und elektromagnetischen Feldern dienen“. Für die Registrierung sieht die Stiftung EAR sechs Kategorien vor.
Was gilt für die Registrierung von Kabeln?
Zum 1. Mai 2019 hat die Stiftung EAR eine Änderung in der Anwendungspraxis eingeführt: Auch passive Endgeräte fallen unter das Elektrogesetz. Diese Art der Umsetzung der WEEE-Richtlinie war in anderen Staaten der EU schon längst gängige Praxis. Deutschland zog erst später nach. Das bedeutet, dass Endgeräte, die für die Durchleitung von maximal 1000 Volt Wechselspannung oder 1500 Volt Gleichspannung vorgesehen sind, auch gemeldet und registriert werden müssen. Diese Geräte werden in den Kategorien 4 bis 6 eingeordnet. Fertig konfektionierte Verlängerungskabel, Lichtschalter, Steckdosen und Stromschienen gelten dabei als passive Endgeräte.
Sind auch Bauteile registrierungspflichtig?
Bloße Bauteile fallen nicht unter das Elektrogesetz. Unter Bauteilen werden Komponenten verstanden, die keine eigenständige Funktion besitzen. Daran ändern auch die oben genannten Änderungen seit Mai 2019 nichts. So fallen beispielsweise Kabel als Meterware, Aderendhülsen und Ringkabelschuhe nicht unter die Registrierungspflicht.
Was ist mit gebrauchten Geräten?
Geräte, die zum Verkauf repariert und aufgearbeitet wurden, müssen nicht registriert werden. Das gilt allerdings nur, wenn der Hersteller sie bereits ordnungsgemäß registriert hat.
Was ist die Garantie?
Mit der sogenannten insolvenzsicheren Garantie soll sichergestellt werden, dass Geräte auch dann entsorgt werden können, wenn für die entsprechende Geräteart kein Hersteller oder Bevollmächtigter mehr registriert ist. Es geht dabei um die finanzielle Absicherung der Entsorgung: Solche Altgeräte müssen dann nämlich über die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger entsorgt werden. Die entsprechenden Kosten werden von der Stiftung EAR erstattet an die Entsorgungsträger erstattet. Diese Kosten werden von der Garantie gedeckt.
Wie schaut es aus, wenn ich in andere Länder der EU handeln möchte?
Wie eingangs erwähnt, ist die WEEE-Richtlinie die Grundlage des Elektrogesetzes. Das bedeutet, dass andere Länder der EU möglicherweise andere Umsetzungen der Richtlinie haben. Im Allgemeinen gilt aber, dass ein Händler, der ein Gerät in ein Land an einen Endnutzer verkauft, in dem er selbst nicht niedergelassen ist, wie ein Hersteller behandelt wird. Das bedeutet, dass dieser Händler in dem jeweiligen Land bei den nationalen Behörden registrierungspflichtig ist.
Online-Händler dürfen hier aber auf die Benennung eines Bevollmächtigten zurückgreifen. Dieser Bevollmächtigte muss allerdings benannt werden, bevor ein Gerät überhaupt in einem anderen Land angeboten wird.
Hat sich mit der Geoblocking-Verordnung daran irgendetwas geändert?
Nein, die Geoblocking-Verordnung sagt lediglich aus, dass Händler Kunden nicht mehr aufgrund ihres Wohnsitzes, oder ihrer Nationalität aus einem Shop aussperren dürfen. Allerdings verpflichtet die Verordnung niemanden dazu, aktiv in alle Länder der EU Handel zu treiben. Kauft ein Kunde ein Gerät in einem Online-Shop, der nicht in das Land liefert, in dem der Kunde sitzt, hat der Händler das Gerät auch nicht in diesem Land angeboten (mehr dazu).
Was ist ein sogenannter Bevollmächtigter?
Ein Bevollmächtigter übernimmt die gesetzlichen Pflichten des Herstellers. Jede zuverlässige und handlungsfähige Rechtsperson mit einer Niederlassung in dem jeweiligen Land kann als Bevollmächtigter benannt werden.
Wie kann ich diese Rücknahme als Online-Händler regeln?
Für Online-Händler ist zur Gewährleistung der Rückgabe eine Kooperation mit dem stationären Handel oder sozialen Einrichtungen denkbar. Es können auch Rücksendemöglichkeiten geschaffen werden. Auf die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger darf allerdings nicht verwiesen werden. Dies würde an dieser Stelle den Sinn und Zweck des Gesetzes unterlaufen. Eine Kooperation ist aber nicht generell ausgeschlossen.
Muss ich die Rücknahmestelle melden?
Ja, und zwar bei der zuständigen Behörde. Zuständig für die Meldung der Rücknahmestelle ist das Umweltbundesamt.
Muss ich über die Rücknahmepflicht informieren?
Händler müssen ihre Kunden über die Rücknahmepflicht und noch mehr informieren:
- Die Rücknahmestellen, die sie selbst geschaffen haben
- Die Eigenverantwortung der Endnutzer im Hinblick auf das Löschen personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten und
- Die Bedeutung des Symbols "durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern"
- Online-Händler müssen seit dem 1. Januar 2022 Altgeräte kostenfrei zurücknehmen und auf die Möglichkeit zur kostenlosen Abholung dem Kunden bereits bei Abschluss des Kaufvertrages hinweisen
Außerdem:
- Über den Umstand, dass Besitzer von Altgeräten diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen haben und
- darüber, dass Altbatterien und Altakkus, die nicht vom Gerät umschlossen sind, vor der Abgabe vom Gerät zu trennen sind
Dieser Informationspflicht kommen Händler nach, in dem sie eine separate Schaltfläche mit der Bezeichnung „Hinweise zur Elektroaltgeräteentsorgung“ einrichten. Auf Marktplätzen, wo so eine zentrale Schaltfläche nicht eingerichtet werden kann, muss der Hinweis in der jeweiligen Artikelbeschreibung erfolgen.
Tipp: Bei der Pflicht zur Nachfrage, ob ein Altgerät wieder mitgenommen werden soll, ist eine gewisse Mitwirkung des Kunden notwendig. Eine konkrete Nachfrage des Händlers hat daher zu erfolgen, umzusetzen beispielsweise durch eine Checkbox.
Ich bin weder Hersteller, noch rücknahmepflichtig – welche Informationspflichten treffen mich?
In diesem Fall sind keine Informationspflichten nach dem Elektrogesetz vorgesehen. Es gibt keinerlei Verpflichtung, den Kunden darüber zu informieren, dass keine Geräte zurückgenommen werden.
Gilt das auch im B2B-Bereich?
Im B2B-Bereich wird vor allem bei der Abholverpflichtung unterschieden: Kann der Hersteller, beziehungsweise der Bevollmächtigte glaubhaft machen, dass das Gerät nicht in einem privaten Haushalt genutzt wird oder nicht für die Verwendung im privaten Haushalt gedacht ist, besteht keine Verpflichtung zur Abholung von B2B-Altgeräten an den Übergabestellen. Sie dürfen auch nicht bei den Sammelstellen oder öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger angeliefert werden.
Was gilt für den Handel auf Marktplätzen?
Mit einer Übergangsfrist bis zum 1. Juli 2023 müssen Marktplatzbetreiber neue Prüfpflichten erfüllen: sie müssen überprüfen ob Hersteller im Sinne des Elektrogesetzes ordnungsgemäß registriert sind. Für Händler, die im Sinne des Elektrogesetzes Hersteller sind, drohen bei fehlender oder mangelhafter Umsetzungen dann Marktplatzsperrungen.

Geschrieben von
Volljuristin Yvonne Bachmann
War dieser Ratgeber hilfreich?
Das könnte dich auch interessieren
- Änderungen im Elektrogesetz: Marktplatzsperrung verhindern
- Regelungen zum Handel mit Elektro- & Elektronikartikeln
- Abmahnung Elektrogesetz Wir helfen sofort
- Neue Informationspflichten für Elektrohändler und -hersteller
- Diese rechtlichen Fallstricke bringt das neue Elektrogesetz
- Für Hersteller: Alles, was du zum Elektrogesetz wissen musst
- Alles Wichtige zur CE-Kennzeichnung » In- und Ausland