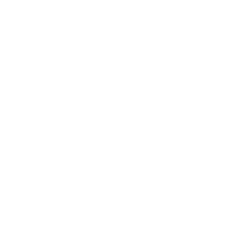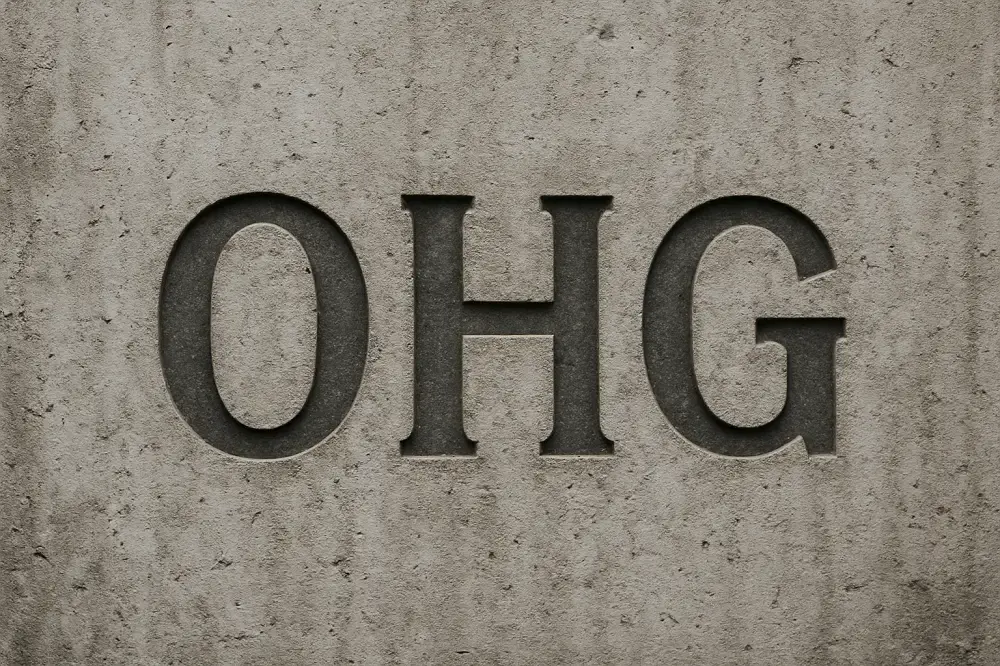Die Gründung einer GbR (Gesellschaft bürgerlichen Rechts) ist oft der schnellste Weg, gemeinsam ein Vorhaben zu starten: wenig Formalitäten, geringe Kosten, hohe Flexibilität. Wer eine GbR gründen will, sollte jedoch die wichtigsten Punkte von Anfang an sauber klären: Haftung (persönlich und gesamtschuldnerisch), Rollen und Vertretung, Gewinnverteilung, Kontoführung sowie Steuern und Buchführung.
Ein schriftlicher Gesellschaftsvertrag ist nicht vorgeschrieben, aber dringend zu empfehlen – besonders bei Eintritt/Austritt von Gesellschaftern oder bei Investitionen. Für Online-Präsenzen kommen zudem Impressum, Datenschutz und Preisangaben ins Spiel.
Dieser Guide führt Schritt für Schritt durch die Gründung einer GbR Planung, Vertrag, Anmeldungen und Praxisfragen.
Was ist eine GbR (Gesellschaft bürgerlichen Rechts)?
Die GbR ist die einfachste Form der Personengesellschaft: Mindestens zwei Personen schließen einen Gesellschaftsvertrag, um einen gemeinsamen Zweck zu verfolgen; sie haften in der Regel persönlich und gesamtschuldnerisch.
Rechtsgrundlage sind §§ 705 ff. BGB. Seit MoPeG (2024) kann eine GbR optional ins Gesellschaftsregister eingetragen werden (eGbR).
Nach § 705 BGB ist die GbR so definiert:
GbR vs. eGbR – Wo liegt der Unterschied
Die GbR entsteht formlos durch Vertrag zwischen mindestens zwei Personen. Sie ist rechtsfähig, aber nicht im Register eingetragen; es gibt keine Publizität über Namen, Sitz und Vertretung. Das ist schlank – reicht jedoch oft nicht, wenn ihr mit Registerrechten zu tun habt (z. B. Grundstückskauf, Beteiligungen, Markenanmeldung).
Die eGbR ist eine eingetragene GbR im Gesellschaftsregister (seit MoPeG 2024). Sie firmiert mit dem Zusatz „eGbR“, hat Registerpublizität (Name, Sitz, Vertretung, Gesellschafter) und kann problemlos in Grundbuch-, Handels-, Marken- oder Patentregister auftreten. Haftung und Innenleben bleiben wie bei der GbR (unbeschränkt, gesamtschuldnerisch) – hinzu kommen Formaufwand (Anmeldung, laufende Änderungsmeldungen, teils Notar) und mehr Transparenz.
Vorteile und Nachteile der GbR
- Schnelle Gründung, geringe Kosten (formloser Vertrag ausreichend)
- Hohe Flexibilität bei Organisation, Vertretung und Gewinnverteilung
- Einfache Buchführung (i. d. R. EÜR statt doppelter Buchführung)
- Kein Mindestkapital erforderlich
- Steuerlich transparent (Gewinne direkt bei den Gesellschaftern)
- Für kleine Vorhaben/Tests geeignet (MVP, Projektstart)
- Option „eGbR“: Registereintrag möglich für mehr Rechtssicherheit bei Registerakten
- Schlanke Verwaltung ohne Pflichtorgane
- Geringe laufende Formalpflichten im Vergleich zu GmbH/UG
- Unbeschränkte, persönliche Gesamtschuldnerhaftung (Haftungsdurchgriff ins Privatvermögen)
- Hohes Konfliktpotenzial ohne klaren schriftlichen Vertrag (Vertretung, Entnahmen, Abfindung)
- Eingeschränkte Außenwirkung und teils geringere Kreditwürdigkeit als Kapitalgesellschaften
- Begrenzte Eigenkapitalbeschaffung; Investoren bevorzugen Kapitalgesellschaften
- Gewerbesteuer möglich bei gewerblicher Tätigkeit; steuerliche Komplexität bei Mischformen
- Haftungsrisiken durch Handeln von Mitgesellschaftern
- Nachfolge/Exit oft aufwendig (Abfindung, Anteilsübertragung)
- eGbR bringt zusätzlichen Form- und Pflegeaufwand (Anmeldung/Änderungen, teils Notar)
- Abmahn- und Compliance-Risiken im E-Commerce (Impressum, PAngV, DSGVO) bleiben voll beim Inhaber
Du bist dir noch nicht sicher, welche Rechtsform zu deinem Vorhaben passt? Mach den Test.
GbR gründen in 10 Schritten
Schritt 1: Partner, Zweck & Risiko klären
Bevor ihr startet: Ziele, Aufgaben, Einlagen (Geld/Sachleistungen/Arbeitsleistung), Zeitaufwand und Erwartungen offen besprechen. Die GbR bedeutet persönliche, unbeschränkte Gesamtschuldnerhaftung – das ist kein Detail. Prüft ehrlich, ob das zu eurem Risiko passt (z. B. Produkthaftung, Abmahnrisiken, Vorfinanzierung).
Kurz-Check:
- Zweck und Geschäftsmodell klar?
- Wer bringt was ein (Zeit, Geld, Know-how, Assets)?
- Worst-Case-Szenarien besprochen?
Schritt 2: Rechtsformvarianten abwägen (GbR vs. eGbR vs. Alternativen)
Die „normale“ GbR ist schnell und günstig, aber ohne Registereintrag. Braucht ihr Registerfähigkeit (z. B. Grundbuch, Markenanmeldung, Beteiligungen), ist die eGbR sinnvoll. Plant ihr Investoren, hohes Haftungsrisiko oder Wachstum, prüft OHG bzw. GmbH oder UG.
Praxis-Hinweis
eGbR: Mehr Formalien (Register, Aktualisierungspflichten), dafür klare Außenwirkung (Vertretung/Sitz dokumentiert).
Schritt 3: Name & Außenauftritt festlegen
Die GbR ist keine „Firma“ i. S. HGB. Nutzt einen verständlichen Namen + nennt die Gesellschafter im Rechtsverkehr. Sichert Domain, Social-Handles und führt vorher eine Markenrecherche durch, um keine Markenrechtsverletzung zu begehen.
Kurz-Check
- Name verständlich, nicht irreführend, keine Schutzrechte verletzt?
- Hinweis im Impressum: „Muster & Partner GbR (Vorname Nachname, Vorname Nachname)“
Schritt 4: Gesellschaftsvertrag erstellen
Formfrei möglich, schriftlich ist vernünftig. Im Gesellschaftsvertrag wird meist geregelt:
- Geschäftsführung/Vertretung
- Gewinn-/Verlustverteilung
- Entnahmen
- Einlagen
- Abfindung
- Ein-/Austritt
- IP-Regelungen
- Nachhaftung
- Geheimhaltung
- Streitlösung (z. B. Schiedsklausel)
- Auflösung
Typische Fehler
- Keine klare Vertretungsregel
- Unklare Entnahmen/Abfindung
- IP-Regelungen vergessen (Marken, Designs, Code, Inhalte).
Eine IP-Regel (Regelung zu geistigem Eigentum) ist der Teil des Gesellschaftsvertrags, der Eigentum, Nutzung und Schutz von immateriellen Gütern festlegt – z. B. Marken, Domains, Designs, Texte, Fotos/Video, Software/Code, Konzepte, Kundendatenbanken.
Schritt 5: Eintragung als eGbR (optional)
Wenn Registerakte anstehen (z. B. Grundbuch, Marken, Beteiligungen), meldet euch im Gesellschaftsregister an (mit Zusatz „eGbR“). Änderungen (Sitz, Vertretung, Gesellschafter) sind zu melden. Rechnet ggf. mit Notar- und Registerkosten.
Kurz-Check
- Benötigen Vertragspartner Registernachweis?
- Vertretungsbefugnisse sauber formuliert?
Schritt 6: Gewerbe/Freier Beruf und Behördenwege
Einordnung – gewerblich oder freier Beruf?
E-Commerce ist regelmäßig gewerblich. Freie Berufe (z. B. Ärzte, Rechtsanwälte, Designer mit reiner schöpferischer Tätigkeit) benötigen keine Gewerbeanmeldung, aber immer die steuerliche Erfassung. Bei Mischformen gilt meist die gewerbliche Prägung.
Gewerbeanmeldung für die GbR
- Wer meldet an? Die Gesellschafter. In der Praxis wird die GbR als Unternehmen bei der Gemeinde am Betriebssitz angemeldet. Gesellschafter werden mit ihren Daten aufgeführt. Manche Ämter verlangen Unterschriften aller oder eine Vollmacht.
- Wann? Vor Aufnahme der Tätigkeit (spätestens mit Start).
- Wo? Gewerbeamt der Kommune (oft online möglich).
- Unterlagen: Personalausweis/Reisepass, Gesellschaftsvertrag (falls vorhanden), ggf. Nachweise/Erlaubnisse (handwerks-/erlaubnispflichtige Tätigkeiten), Vollmacht bei Vertreter.
- Angaben im Formular: Name und Anschrift der GbR, tatsächliche Tätigkeit präzise, aber zukunftsfest (z. B. „Handel mit …, Online-Handel über eigene Website und Marktplätze, Erbringung von Service-/Logistikleistungen“), Beginn, Betriebsstätte, Gesellschafter.
- Gebühr: je nach Kommune ca. 20–60 €.
Wichtig für GbR:
- Nebenstellen/weitere Betriebsstätten separat anmelden.
- Änderungen (Tätigkeit, Anschrift, Gesellschafter) unverzüglich anzeigen (§ 14 GewO).
- Kein Handelsregister für die „normale“ GbR; eGbR (falls gewählt) separat im Gesellschaftsregister.
Automatische Meldungen & Folgewirkungen
Mit der Gewerbeanmeldung informiert die Gemeinde i. d. R. automatisch:
- Finanzamt: Du erhältst den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung.
- IHK (bei Handwerk: HWK): Pflichtmitgliedschaft/Beiträge je nach Satzung.
- Berufsgenossenschaft: Innerhalb einer Woche nach Gründung anmelden.
- Gewerbezentralregister (falls relevant).
Steuerliche Erfassung (beide Fälle – Gewerbe und freier Beruf)
- Fragebogen ans Finanzamt: Steuernummer, ggf. USt-IdNr. beantragen.
- Kleinunternehmerregelung (§ 19 UStG) wenn gewünscht im Steuerfragebogen wählen.
- Bankverbindung, Buchführung (EÜR) und Fristen festlegen.
Erlaubnisse und Spezialfälle
Für bestimmte Tätigkeiten sind Erlaubnisse nötig (z. B. Bewachung, Finanzdienstleistungen, Reisegewerbe). Handwerkspflichten prüfen (Anlage A/B HwO). Bei Import/Export: EORI-Nummer beantragen.
Typische Fehler
- Zu enge Tätigkeitsbeschreibung → spätere Erweiterung kostet Zeit.
- Verspätete Anmeldung → Ordnungswidrigkeit möglich.
- Keine BG-Meldung → Nachfragen/Beitragsbescheid.
- IHK/HWK ignoriert → Beitragsbescheid ohne Budgetierung.
- Nur privat geführtes Konto → Beleg- und Steuerchaos.
Mehr Informationen zum Thema:
In unserem Ratgeber erfährst du alles zur Gewerbeanmeldung und welche Fehler du vermeiden solltest.
In unserem Ratgeber erklären wir dir, wie du Schritt für Schritt ein Kleingewerbe gründest.
In diesem Ratgeber erklären wir, die Vorteile der Kleinunternehmerregelung.
Schritt 7: Konto, Zahlungswege & Administration
Ein gemeinsames Geschäftskonto ist kein Muss, aber kaufmännischer Standard. Legt Vollmachten/Zeichnung, Rechnungsprozesse (Nummernkreis, Zahlungsziele, Mahnwesen) und Liquiditätsplanung fest.
Kurz-Check
- Kontozugriff geregelt (Einzel-/Gemeinschaftsverfügung)?
- Rechnungs-Template mit Pflichtangaben (GbR-Name, Anschrift, Steuernummer/USt-IdNr.)?
Ratgeber: Wie schreibe ich eine Rechnung?
Schritt 8: Buchführung & Steuern organisieren
In der Regel reicht eine Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR). Trotzdem: Sauberes Belegwesen, Kontenplan, Fristenliste (USt-Voranmeldung, ESt, GewSt ggf.), Tool (Buchhaltungssoftware) wählen. Zuständigkeiten definieren (wer bucht, wer prüft, wer gibt frei).
Praxis-Tipp
Von Beginn an privat und geschäftlich trennen. Mischmasch ist der häufigste Fehler.
Ratgeber: Steuern im E-Commerce » was du beachten musst
Schritt 9: Haftung & Versicherung
Die Haftung greift auch für Fehler des Partners. Prüft Betriebshaftpflicht, je nach Tätigkeit Vermögensschaden-, Cyber- und Produkthaftpflicht. Vereinbart intern Compliance-Standards (Freigaben, Vier-Augen-Prinzip).
Kurz-Check
- Risikoanalyse gemacht (Branche, Ticketgrößen, Liefertermine)?
- Versicherungsnachweise dokumentiert?
Schritt 10: Online-Präsenz & E-Commerce-Pflichten (falls relevant)
Wenn du eine Website oder einen Online-Shop betreibst, musst du dich an die rechtlichen Vorgaben halten, z. B. Informationspflichten. Sonst drohen kostspielige Abmahnungen, die gerade am Anfang ärgerlich sind. Deshalb ist es empfehlenswert, sich beim Start auch um die Rechtssicherheit zu kümmern.
Typische Abmahnfallen:
- Fehlende oder falsche Grundpreise (PAngV)
- Veraltete Widerrufsbelehrung oder fehlende Muster-Widerrufsformulare
- Mangelnde Produktkennzeichnungen (z. B. Energie-/Effizienzlabel, Textilkennzeichnung, LMIV bei Lebensmitteln)
- Irreführende Preiswerbung (falsche Streichpreise/UVP, fehlende Versandkostenhinweise)
- Unklare Lieferzeiten/Verfügbarkeiten („sofort lieferbar“ ohne Bestand)
- Impressum fehlt/unvollständig; Datenschutzerklärung lückenhaft
- Cookie-Consent fehlerhaft (Tracking ohne Einwilligung, Dark Patterns)
- Garantiewerbung ohne Bedingungen/Kontakt des Garantiegebers
- Urheber-/Markenrechtsverletzungen (Bilder, Logos, Produktnamen ohne Rechte)
- Unzulässige AGB-Klauseln (z. B. pauschaler Gewährleistungsausschluss)
- Unerlaubte Werbe-E-Mails ohne Einwilligung (kein Double-Opt-In)
- Keine Verpackungsregistrierungen (z. B. LUCID, ElektroG/BattG)
- Irreführende Umweltclaims („klimaneutral“, „plastikfrei“) ohne belastbaren Nachweis
Gründung einer GbR: Was der Händlerbund für dich tut
Wir erstellen individuell auf dein Business angepasst Rechtstexte. Inkl. Update-Service.
Guter Rat ist nicht teuer. Egal ob per E-Mail, Telefon oder Chat – wir beantworten deine Fragen.
Lass deinen Online-Shop auf über 100 Abmahnfallen prüfen und sichere dir Schutz für dein Business.
Wir vertreten dich auch rückwirkend bei Abmahnung und das ohne zusätzliche Kosten.
* Alle Preise netto zuzüglich gesetzliche Mehrwertsteuer. Die Mindestlaufzeit beträgt 12 Monate.
** Hilfe bei Abmahnungen ist eine freiwillige solidarische Unterstützungsleistung für Mitglieder des Händlerbund e.V. Die Bedingungen der Abmahnhilfe ergeben sich aus der Rechtsschutzordnung des Händlerbund e.V.